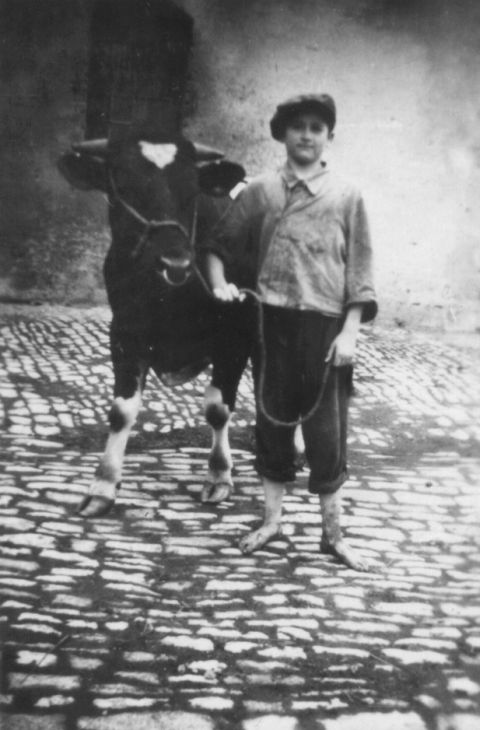|
Zwangsarbeiter
und Kriegsgefangene im Dritten Reich in Heuchlingen Einführung Erzeugungsschlacht 1938 - Vorboten einer großen Sache? Vorgeschichte Erst verpönt - dann willkommen
Zwangsmaßnahmen Arbeitspflicht auch für deutsche Staatsbürger- aus Gd. Akten - 2012 Prekärer Arbeitskräftemangel in der deutschen Landwirtschaft .
Es reichte wohl nicht aus. Die Eingaben nach Arbeitskräften
nahmen zu. Schon 1938 haben auch in Hchl. landwirtsch.
Betriebe Arbeitskräfte angefordert. Für 21 Betriebe wurden Betriebskarteien
angelegt. – in der Anlage
(in pdf) sehen wir eine solche Eingabe nach Arbeitskräften
aus dem Jahr 1942. Auch Ehefrauen, Mütter und Witwen, wurden nun
verpflichtet während der Erntesaison zumindest stundenweise sich als
Arbeitskraft einzubringen- - s.
auch hierzu eine kurze Auflistung in den Anlagen Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterklassen
. Zwangsarbeiter waren nicht gleich Zwangsarbeiter.
Die Menschen aus den Ostgebieten wurden nach ihrer Herkunft bewertet.
Als Angehörige von "Arbeitsvölkern" wurden die ausländischen
Arbeitskräfte gegenüber den deutschen "Herrenmenschen" durch
zahlreiche Bestimmungen deklassiert und entrechtet. Dabei zeigte die
unterschiedliche Behandlung der verschiedenen Nationen ein hierarchisches
System, bei dem die Zwangsarbeiter und - Arbeiterinnen aus der Sowjetunion
auf der untersten Stufe standen, gefolgt von den Polen und Polinnen. In der oberen Bewertungsstufe des "Reichseinsatzes" standen
die Tschechen, die als Bewohner des "Protektorats Böhmen u. Mähren"
1939 zu Inländer (zweiter Klasse) erklärt wurden. Da die Meldung von
Freiwilligen auch dort nicht das gewünschte Ausmaß erreichte, gingen
die deutschen Besatzer schon 1939 zu Zwangsmaßnahmen über. Einen Sonderstatus hatten auch Arbeitskräfte aus der Ukraine
und den baltischen Staaten. Offensichtlich wurde mit den dortigen
Behörden ein Sonderstatus ausgehandelt. So erfuhren die ukrainischen
Landarbeiterinnen eine verhältnismassig großzügige Reisefreiheit und
Urlaubsgewährung zum Besuch ihrer Angehörigen in der Heimat- wie es
am Beispiel der Ukrainerin Rusin Anna - s. Arbeitsbuch 332/001849
A.B. zu sehen ist. Auf der untersten Stufe standen, wie schon erwähnt, die Russen,
gefolgt von den Polen. Polnische Arbeitskräfte
. So
wurden auch
die Bauern kleinerer landwirtschaftlicher Betriebe dazu
angehalten, ihre polnischen Arbeitskräfte getrennt vom übrigen Gesinde
unterzubringen und sie auch bei den Mahlzeiten zu separieren. Um sexuelle
Beziehungen zwischen Polen und deutschen Frauen zu unterbinden, wurde
das Reichsarbeitsministerium aufgefordert, dafür Sorge zu tragen,
dass ebenso viele polnische Frauen wie Männer in einer Region zum
Arbeitseinsatz kämen. Schwangerschaften blieben natürlich nicht aus - wie
auch? Schwangere Zwangsarbeiterinnen aus Polen und der Sowjetunion
wurden ab 1943 zur Abtreibung genötigt oder mussten ihre Kinder in
Entbindungsbaracken zur Welt bringen. Nach wenigen Tagen hatten sie
an ihre Arbeitsstätten zurückzukehren. Die Babys blieben in den Baracken
zurück, oder wurden in Säuglingslagern untergebracht. Im NS-Sprachgebrauch
wurden die Säuglingssammellager hochtrabend "Ausländerkinderpflegestätte"
genannt. Diese dunkle Geschichte haben wir in einem separaten Abschnitt kurz ausgeleuchtet. Erträgliches
Los in der
Landwirtschaft. Ostarbeiter Einsatz von Kriegsgefangenen. Mit Fortdauer des Krieges kamen jetzt
auch immer mehr Kriegsgefangene als Arbeitskräfte im Reich zum Einsatz.
Die polnischen Kriegsgefangenen. wurden schon nach einigen Monaten
bis auf wenige Tausend in den Zivilstatus überführt, ebenso die Niederländer.
Dann arbeiteten bis zu 1,3 Mill. französische Kriegsgefangene zeitweise
in der deutschen Wirtschaft. 90 000 wurden gegen französische Zivilarbeiter
ausgetauscht. Ca. 220 000 wählten die Möglichkeit, durch Überführung
in den Zivilstatus mehr Geld zu verdienen - handelten sich in der
Heimat dadurch aber den Vorwurf der Kollaboration ein. Sowjetische Kriegsgefangene wurden in den ersten Monaten nach
dem Russlandfeldzug im Juni 1941 nur sehr selten im Reichsgebiet eingesetzt.
Über 2 Mill. ließ die Wehrmacht verhungern. Erst Ende Okt. 1941 erfolgte
dann der Einsatz im Reich, vorzugsweise im Bergbau. Etwa die Hälfte
von ihnen starb. Ein etwas besseres Schicksal als die Sowjets erlitten
die etwa 500 000 italienischen "Militärinternierten" nach
dem Spätsommer 1943. ............................................ ............................................ Zwangsarbeiter
und Kriegsgefangene in Heuchlingen Zwangsarbeiter in Heuchlingen Im Einwohnermeldeamt Heuchlingen liegen
ein "Zugangs- und Abgangsbuch zur Meldekartothek" vor. In
diesen Büchern sind die Zuzüge/Abgänge aller -also auch deutsche,
Personen nach Heuchlingen, bzw. deren Wegzug, im Zeitraum von 1929
bis 1946 erfasst. Der Arbeitseinsatz Der Einsatz der Fremdarbeiter war streng
geregelt. Alle Personen mussten ihre (gelben) Arbeitskarten ständig
bei sich führen. An der Arbeitskleidung musste, wie schon erwähnt, das Polenzeichen "P" fest angenäht sein. Der Gemeindebezirk
durfte nur mit schriftlicher Genehmigung des Arbeitgebers - nach deren
Vorlage bei Meldebehörde - und in dringenden Fällen erlaubt werden
- z.B. Arztbesuche, Besuch von Verwandten auf anderen Arbeitsstellen
u.a. Wurde der Arbeitsplatz aus persönlichen Gründen - Arbeitsunlust
usw. verlassen, hatte die Ortspolizeibehörde unverzüglich die Staatspolizeileitstelle
zu unterrichten. Sonderregelungen Geschlechtsverkehr zwischen Deutschen und Fremdarbeitern
war strengstens untersagt und wurde schwer bestraft. (in der Praxis
hier - naturgemäß - besonders die Fremdarbeiter) Unterbringung (hier besonders von Fremdarbeiter
aus altsowjetischen Gebieten)
. Bild: Fremdarbeiter b. d. Heuernte
. Die Praxis. Bei der Sichtung der Aktenmappe - sofern
vollständig, zeigte sich, dass die genannten u. ungenannten Vorschriften
auch in Heuchlingen pragmatisch gehandhabt wurden. So erfolgten die
Wechsel einzelner Fremdarbeiter auf den verschiedenen Anwesen oder
deren Tausch scheinbar oft ungeordnet. Auch in der Frage der getrennten
Unterbringung - es fehlten oft die erford.
Räumlichkeiten- oder der vorgeschriebenen getrennten Malzeiten,
entschieden die Gegebenheiten - wobei hier sehr wohl Unterschiede
bei den einzelnen Anwesen zu sehen sind. Diese, nicht selten laxe
Befolgung der einschlägigen Erlasse, kommt dann auch in scharfen Stellungnahmen
der Reichsführer immer wieder zum Ausdruck. Am Ende – Rache . Kriegsgefangene in Heuchlingen und Zeitzeugenwissen Zeitzeugen wissen noch von 5 Franzosen in Holzleuten,
2 Franzosen auf dem Mäderhof, 1 Franzose auf dem Riedhof und 3
- 4 Franzosen in Heuchlingen. Diese Angaben würden 11 bis 12 Kriegsgefangene
für Heuchlingen ergeben. Die amtlichen Zahlen hierzu Anlässlich einer polizeilichen Verfügung vom
Aug. 1941 zur Benutzung von Fahrrädern durch Kriegsgefangene, wurden
13 Arbeitgeber in Heuchlingen,
bei denen Kriegsgefangene im Einsatz waren, von dieser Verfügung in
Kenntnis gesetzt. Allerdings sind die zugeteilten Kriegsgefangenen namentlich nicht vermerkt. Nicht aufgeführt
sind hier die Anwesen Klotzbücher in Holz. und das Riedhofanwesen.
– siehe Anhang
S. …. In Heuchlingen kamen nur französische
Kriegsgefangene zum Einsatz . Die Anzahl der
eingesetzten Kriegsgefangenen in Heuchlingen . Über die Anzahl
der Kriegsgefangen
in Heuchlingen gibt die Aktenlage folgendes Bild: Die Namen der Kriegsgefangenen und ihre Arbeitsstellen in Heuchlingen Etwas zum Verdienst und Verpflegung
. Unterbringung und Bewachung - was wissen
Zeitzeugen? Gefangenenlager im Schloß. Wie ob. schon erwähnt, wurde nach dem sogen. Blitzkrieg gegen Frankreich 1940 für die nach Hchl. zugeteilten Kriegsgefangenen im Schloss ein Gefangenenlager mit einer Kommandantur eingerichtet. Nach Bruno
Bihlmaier oblag die Überwachung der Kriegsgefangene zu Beginn der
ersten Internierungen einem Wachmann der Wehrmacht. Für den Wachmann
wurde im Haus des Dorfbüttels Xaver Bihlmaier- es lag in unmittelbarer
Nähe beim Schloss, ein Wachzimmer eingerichtet und mit einer eigens
vom Schloss zum Wachzimmer des Hauses verlegten Alarmleitung versehen . Der Aktenlage nach hatten sowohl ein Wachsoldaten,
als auch Xaver Bihlmaier und weitere Hilfswachmänner die Überwachung
der Gefangenen inne. Zum Thema "Wachmann" gibt es auch die
Aussage v. Karl Hirth in Hlzl: ...... dass
sein Vater des Öfteren am Abend die Gruppe der Soldaten von Hlzl.
nach Heuchlingen ins Schloss abgeführt hat. Der Gang zur Arbeitsstelle . Linus Wagner, 1928 - 1942 Pfarrer in
Hchl., hielt einmal im Monat mit den
französischen Kriegsgefangenen am Marienaltar einen Sonntagsgottesdienst.
Oft wurde dabei auch das "Lourdes-Lied" gesungen. Die Soldaten
haben nach den Erinnerungen sehr schön und ergreifend gesungen. Besonders "Jean"- der bei J. Ilg, d. "Kolba-
Done" eingesetzt war, ist mit seiner schönen Stimme noch in guter
Erinnerung. Anton Knödler durfte bei diesen Gottesdiensten des Öfteren
als Messdiener mit dabei sein. Abzug der französischen Gefangenen
- aus Zeitzeugenaussagen. Die gefangenen Franzosen hatten einmal
den Wunsch geäußert eine kleine Feier zu abzuhalten – ob Nationalfeiertag
od. Weihnachtsfeier ist nicht bekannt. Hierzu wurde von ihren Bauern kleine Geschenke
und wohl auch Getränke und Essbares gesammelt und den Soldaten überreicht.
Aug. Haas v. Mäderhof hatte davon Wind bekommen und die Sache zur
Anzeige gebracht. Die Gefangenen wurden daraufhin abgezogen und in
andere Lager und Arbeitsstellen verlegt. - Rudolf Schmid erwähnt hier
Obergröningen als neues Gefangenenlager. Der Wachsoldat wurde angeblich
an die Front versetzt. Leider sind über all die gemachten Aussagen
keine genauen zeitlichen Vorstellungen mehr vorhanden. Qu. O. u. R. Schmid. In gesondert ausgearbeiteten Einzelobjekten wir versucht, die Geschichte der Zwangsarbeiter und Kriegsgefangenen in Heuchlingen näher anzugehen. Die Geschichten beruhen überwiegend auf noch vorhandenem Wissen von Zeitzeugen. Quellen: verschiedene
Gemeindeakten, ergänzt durch kurze Auszüge diverser Beiträge im Internet,
wie: "Damals-Zwangsarbeiter im Dritten Reich, Nr. 2/2000, S.
35ff, v. Mark Spoerer* und Internet-Beitrag von "Birgit Maas,
Berlin°. |