|
Heuchlingen
und seine Brücken
"Schon zur Hallstadtzeit"
(800 - 400 Jahren vor Chr.) führte eine bedeutende Straße durch
unser Dorf - die Salzstraße. Ihr Verlauf ging von Schechingen
kommend über
die Hirtengasse, durch die Furt in der Lein , anschließen in etwa
auf der Trasse der Alten Mögglinger Straße,
 weiter in Richtung Süden. Die Geschichtsforschung
spricht von einem bereits *lebhaften Verkehr auf dieser Straße. Hm?
Also *lebhafter Verkehr durch Heuchlingen,
über die *Hirtengasse und über die Lein.
So die Notierungen in der Broschüre "Heuchlingen
und seine Brücken", ausgelegt bei der Gemeind-verwaltung.
(Nicht untersucht ist wohl der Leinverlauf -
also die von Talseite zu Talseite stoßende Lein - damals, vor 2
1/2 Tausend Jahren. .......
weiter in Richtung Süden. Die Geschichtsforschung
spricht von einem bereits *lebhaften Verkehr auf dieser Straße. Hm?
Also *lebhafter Verkehr durch Heuchlingen,
über die *Hirtengasse und über die Lein.
So die Notierungen in der Broschüre "Heuchlingen
und seine Brücken", ausgelegt bei der Gemeind-verwaltung.
(Nicht untersucht ist wohl der Leinverlauf -
also die von Talseite zu Talseite stoßende Lein - damals, vor 2
1/2 Tausend Jahren. .......
---------------------------- Bild:
Karte um 1800.
............................................
Fuhren und Wege im Mittelalter - spätes Mittelalter
- frühe Neuzeit.
Warentransporte - Fuhren - Wege.
Hierzu ein kurzer Abschweif zu - damals
- wie es in diversen Abhandlungen gelesen werden kann:
Die Wege kreuzten sich oft an markanten Punkten – markantes Gelände, an der Kreuzung gepflanzte
markante Bäume, Feldkreuze, Steinblöcke o. ä.
Flüsse durchquerte man an seichten Stellen, Sümpfe umging man
möglichst komplett.
Die Ortsverbindungswege führten nicht selten geradewegs hoch
über Anhöhen und von dort wieder steil nach unten zum nächste
 n Ort.
n Ort.
 Weiter
wurden in früher Zeit ein Großteil der
Waren und Gegenstände – oft über lange Strecken - auf dem Rücken, mit dem Handkarren, mit dem Pferd
oder zu Fuß transportiert. Man denke hier an die zahlreichen Wander-krämer,
Wanderhandwerker, Frucht – und Schmalzträger oder an die zahlreichen Botengänger.
Weiter
wurden in früher Zeit ein Großteil der
Waren und Gegenstände – oft über lange Strecken - auf dem Rücken, mit dem Handkarren, mit dem Pferd
oder zu Fuß transportiert. Man denke hier an die zahlreichen Wander-krämer,
Wanderhandwerker, Frucht – und Schmalzträger oder an die zahlreichen Botengänger.
Eingeflochten:
noch weit hinein im 19 Jh. wurde die Kirchenwäsche (Altartücher
u. a.) von Heuchlingen in ein Kloster nach Gmünd zur Wäsche getragen,
andere, zusammen mit Kerzen,
Hostien u.a. auf den Rückweg per Fuß wieder abgeholt.
Die
Korbmacher trugen ihre Körbe auf dem Rücken zu den umliegenden
Märkten. Ähnliches wird auch von den "Käsern"
und Brotbäckern angenommen. Nicht vergessen werden dürfen
auch die Hanwerker, wie: Schneider, Schuster, Scherenschleifer, Pfannenflicker,
aber auch Maurer, Wagner, Zimmerleute u. a., welche früher -
bis weit hinein ins 20te Jh, mit ihrem Hand-werkzeug auf dem Rücken
oder auf dem Handkarren zu ihrer Kundschaft auf dem Land zogen, um
dort ihre Tätigkeit zu verrichten.
Wichtig zu nennen sind jetzt dann auch all die Gasthäuser und Herbergen
am Weg. Die Fuhrleute und die Tranporttiere brauchten Ruhezeiten,
Futter, Essen und Trinken.
............
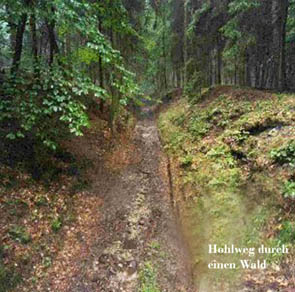 Wege und Fuhren.
Die Wege für den Landverkehr waren in den allermeisten Fällen nichts
anderes als Fahrspuren, die in Schlechtwetterperioden
durch das Aufbringen von Reisig einigermaßen stabil gehalten, in besonderen
Fällen durch die Anlage von Knüppeldämmen gefestigt wurden - und trotz
Alledem nicht mehr befahrbar waren.
Wege und Fuhren.
Die Wege für den Landverkehr waren in den allermeisten Fällen nichts
anderes als Fahrspuren, die in Schlechtwetterperioden
durch das Aufbringen von Reisig einigermaßen stabil gehalten, in besonderen
Fällen durch die Anlage von Knüppeldämmen gefestigt wurden - und trotz
Alledem nicht mehr befahrbar waren.
* Hierzu kann vielleicht
eingeflochten werden, dass die Fuhrwerk-Gespanne noch im 17. Jh. nicht
doppelspännig, sondern einspännig
waren.
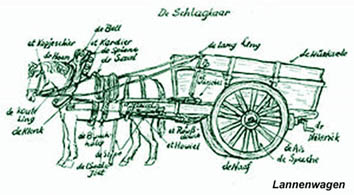 Dabei war
die übliche Bespannungsart: hintereinander laufende Pferde oder andere
Zugtiere - die Fuhren und Wege jener Zeit waren deshalb auch schmal
und ließen keinen Gegenverkehr zu. Diese Spannmethode mit bis zu 8
oder gar 10 Zugtieren an einer Reihe,
hinterließ
Dabei war
die übliche Bespannungsart: hintereinander laufende Pferde oder andere
Zugtiere - die Fuhren und Wege jener Zeit waren deshalb auch schmal
und ließen keinen Gegenverkehr zu. Diese Spannmethode mit bis zu 8
oder gar 10 Zugtieren an einer Reihe,
hinterließ  auf den Fuhren und Wegen mit der Zeit eine
tiefe Rinne - die meist mit Holzreisig
und Knüppeln ausgefüllt wurden. Oft aber waren die Wege auch unpassierbar
und mussten mit großem Zeitaufwand umfahren werden. Siehe auch --
http.www.bayernsammler.de/pg/pe/wa2.html - (kleines
Bild ob. rechts: sogenannter "Lannenwagen"
für hintereinander Gehenden Zugtieren) auf den Fuhren und Wegen mit der Zeit eine
tiefe Rinne - die meist mit Holzreisig
und Knüppeln ausgefüllt wurden. Oft aber waren die Wege auch unpassierbar
und mussten mit großem Zeitaufwand umfahren werden. Siehe auch --
http.www.bayernsammler.de/pg/pe/wa2.html - (kleines
Bild ob. rechts: sogenannter "Lannenwagen"
für hintereinander Gehenden Zugtieren)
..
Brücken
im Leintal, im späteren Mittelalter
und frühen Neuzeit.
Mit
dem Aufkommen u. erstarken des "Staufer"- Geschlechtes
im 11 - 13. Jh. entstanden auch zahlreiche Ministeriale. Deren Verdienste wurden
durch Lehen, bestehend aus Ländereien mitsamt den dazugehörenden
Orte und
samt deren Bevölkerung belohnt.
...............
So anstanden in jener Zeit auch im
weiten Leinbereich und dessen Umland zahlreiche Ritter und 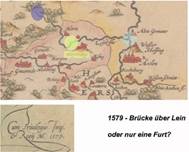 Grafengeschlechter.
Als wichtigstes Adelsgeschlecht sind hier die Herren von Rechberg
zu nennen, welche im 13 Jh. neben Heuchlingen auch andere Orte im
Kochertal, in Schechingen u. weitere zeitweise als Lehen im Besitz
haben. In Hohenstadt zeichnen in dieser Zeit auch die Grafen v. Öttingen.
Neben diesen genannten taucht auch immer wieder der Einfluss und die
Teilhabe des Klosters Ellwangen auf. Grafengeschlechter.
Als wichtigstes Adelsgeschlecht sind hier die Herren von Rechberg
zu nennen, welche im 13 Jh. neben Heuchlingen auch andere Orte im
Kochertal, in Schechingen u. weitere zeitweise als Lehen im Besitz
haben. In Hohenstadt zeichnen in dieser Zeit auch die Grafen v. Öttingen.
Neben diesen genannten taucht auch immer wieder der Einfluss und die
Teilhabe des Klosters Ellwangen auf.
....
Jetzt,
im 13. Jh. erbauen die Herren von Rechberg
auch die
 erste Burg in Heuchlingen. Weitere Burgen entstehen
noch im weiteren Leinbereich und auf der Anhöhe zur Frickenhofer
Höhe. erste Burg in Heuchlingen. Weitere Burgen entstehen
noch im weiteren Leinbereich und auf der Anhöhe zur Frickenhofer
Höhe.
In der Stauferstadt Gmünd anstanden die ersten Klöster. Diese
erwarben schon sehr schnell große Schenkungen, welche wiederum als
Bauernlehen vergeben vergeben wurden. So
z.B. in Holzleuten, wo allein 8 größere Bauernlehen entstanden.
So verwundert es nicht, dass schon sehr bald lebhafter Verkehr
in und um Heuchlingen stattgefunden hat. Ein Beispiel, gekürzt dargelegt:
Eine Poststation in Heuchlingen (wahrsag. Der"Adler")
im März 1553 erschien in Stuttgart eine Kanzleiordnung, wonach
bei der Kanzlei ein eigener Botenmeistera aufgestellt
werden mauset. Unter Herzog Friedrich I. (1593-1608) wurde das Postwesen
sodann fest organisiert, indem er bestimmte Botenkurse
für Fußgänger und zu Pferd mit regelmäßigen Abgangs-
und Ankunftszeiten eingeführt ließ. Eine dieser Postkurse
führte über das Remstal von Stuttgart, Schorndorf, Mögglingen,
Aalen, weiter nach Ellwangen nach Nürnberg.
Eine weitere zweigte von Mögglingen ab nach Heuchlingen und
führte weiter über Abtsgmünd wiederum nach Ellwangen und hinauf
nach Schechingen, Hohenstadt und die Frickenhofer
Höhe.
Auf diesen Kursen befanden sich mit Botenmeistern besetzte
Stationen, u. a. in Schorndorf, Gmünd und Heuchlingen im Leintal.
Die von Stuttgart aus nach diesen Stationen bestimmten Briefe und
Sachen wurden an die dortigen Boten zur Bestellung abgegeben.
Namentlich der Heuchlinger Bote
scheint einen großen Bestellbezirk gehabt zu haben, wie seine Abrechnung
mit dem Stuttgarter Botenmeister vom Jahr 1584 ergibt. Der Bote erhielt,
nebst Sommer- u. Winterkleidung, 20 Gulden, 6 Malter Korn u. 12 Scheffel
Haber. Ein interessanter Vermerk hierzu: "zur Abstellung von
Saumseligkeiten in der Beförderung der herzoglichen
Briefschaften, die dem Heuchlinger Boten zur Last fielen, ihn der Graf v. Rechberg einige Tage (1583) einsperren ließ".
Das
Postwappen war der Reichsadler.
So waren die meisten Gasthäuser  "zum
Adler" zugleich Poststationen - so auch unser "Adler".
Im EG befanden sich die Stallungen, Lager und die Poststelle und im
oberen Stock die Gaststuben und Beherbergungsräume. Diese Details finden sich im Pfarrarchiv Hchl., Krt. 37 - erforscht im Stadtarchiv Schw. Gmünd. (ehedem
nur "Gmünd") "zum
Adler" zugleich Poststationen - so auch unser "Adler".
Im EG befanden sich die Stallungen, Lager und die Poststelle und im
oberen Stock die Gaststuben und Beherbergungsräume. Diese Details finden sich im Pfarrarchiv Hchl., Krt. 37 - erforscht im Stadtarchiv Schw. Gmünd. (ehedem
nur "Gmünd")
Weiter zur "Brückengeschichte in Heuchlingen" zu den
Objekten in Pos. 13 / Bereich 3.
|



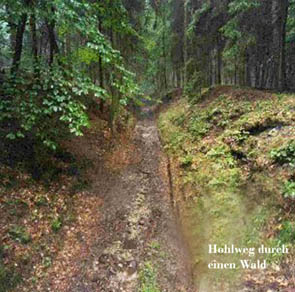
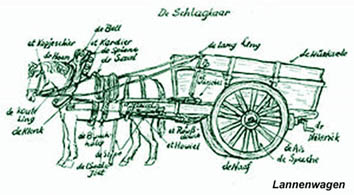
 auf den Fuhren und Wegen mit der Zeit eine
tiefe Rinne - die meist mit
auf den Fuhren und Wegen mit der Zeit eine
tiefe Rinne - die meist mit 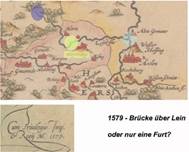
 erste Burg in Heuchlingen. Weitere Burgen entstehen
noch im weiteren Leinbereich und auf der Anhöhe zur
erste Burg in Heuchlingen. Weitere Burgen entstehen
noch im weiteren Leinbereich und auf der Anhöhe zur  "zum
Adler" zugleich Poststationen - so auch unser "Adler".
Im EG befanden sich die Stallungen, Lager und die Poststelle und im
oberen Stock die Gaststuben und Beherbergungsräume.
"zum
Adler" zugleich Poststationen - so auch unser "Adler".
Im EG befanden sich die Stallungen, Lager und die Poststelle und im
oberen Stock die Gaststuben und Beherbergungsräume.