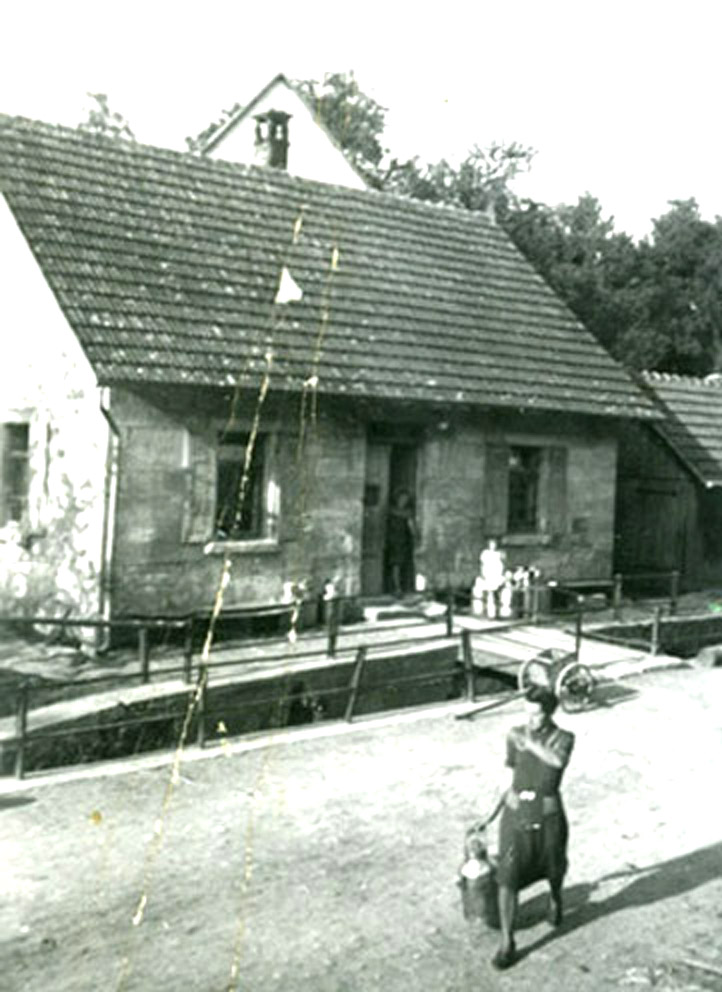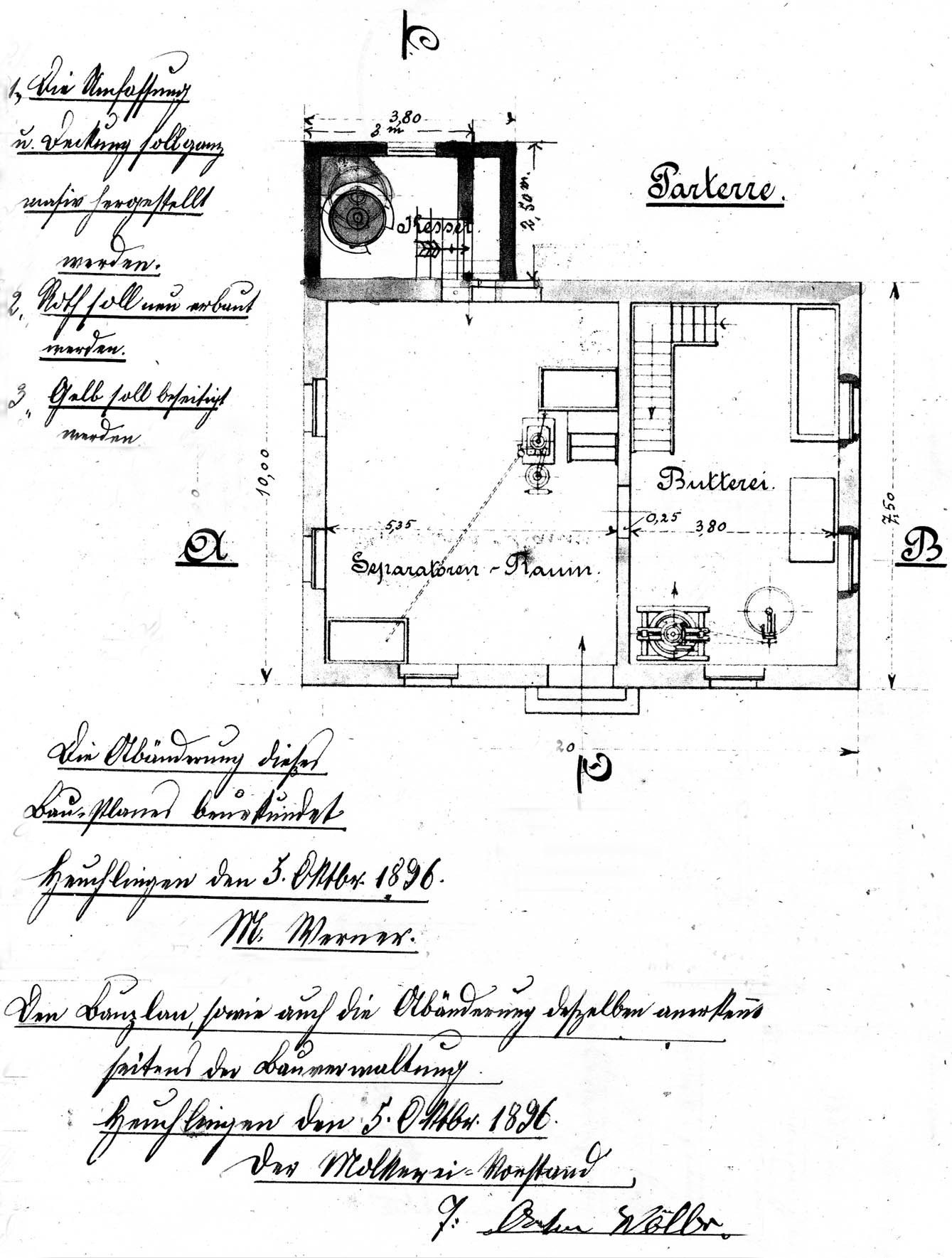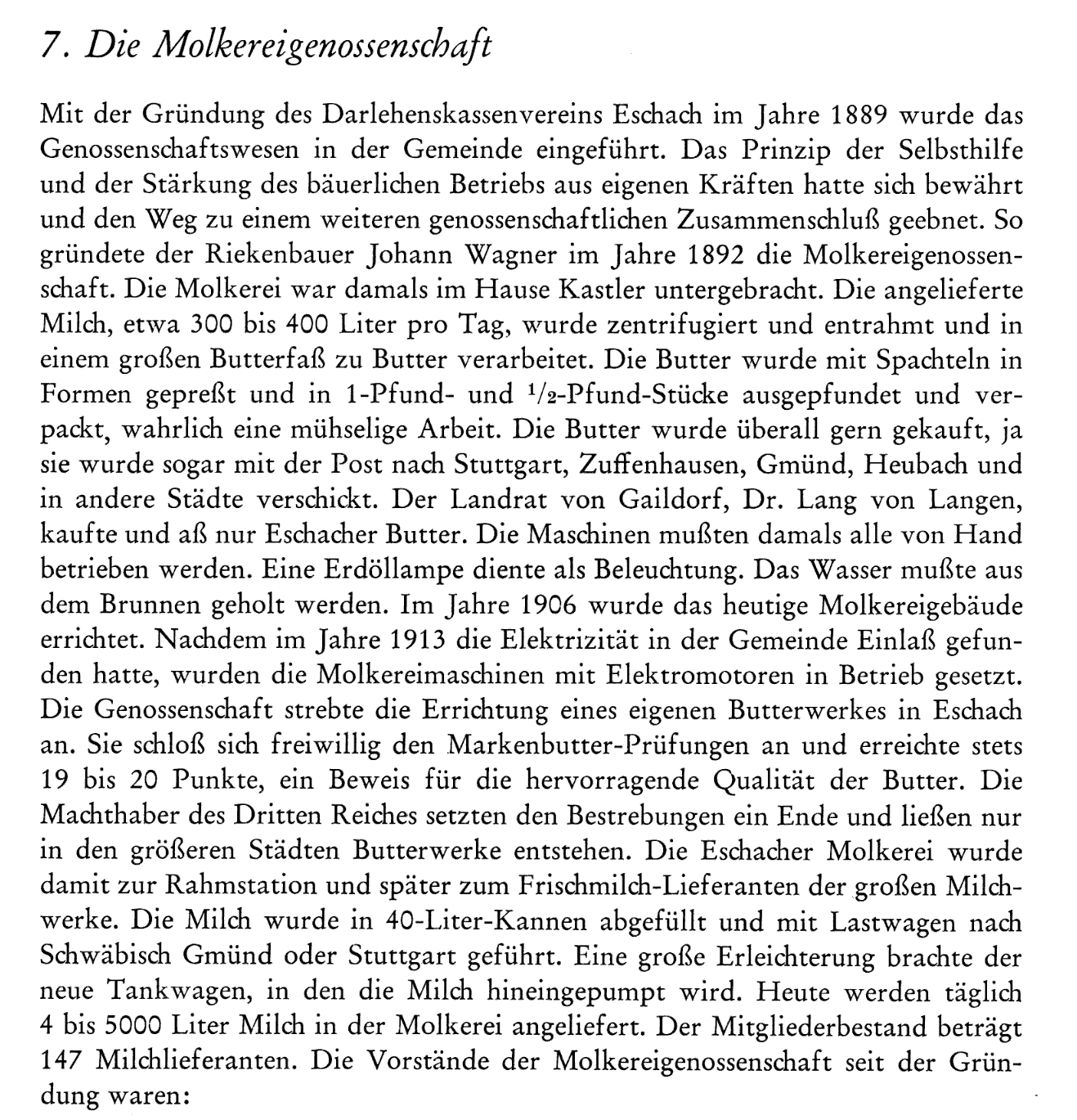|
Die
wirtschaftlichen Zustände auf dem Land in den ersten beiden Drittel
des
19. Jahrhunderts.
Auswertungen von Kaufbücher in Heuchlingen aus dem 19. Jahrhundert
zeigen bei den einzelnen Bauernanwesen auf einen nur geringen
Milchviehbestand. Kaum ein Bauer hatte mehr als drei bis 4 Kühe,
dazu 2 bis 3 Paar Ochsen als Zugvieh.
Pferde galten
als unnütze Fresser und wurden nur von zwei oder 3 größeren
Bauern gehalten.
Die Zustände zeigen auch die beiden nachstehenden
Beispiele:
Im Febr. 1838
verkauft Friedrich Bäuerle an seinen led. Sohn Bernhard Bäuerle
sein Anwesen Haus 74 - "Mertisbauer" am Kirchberg, für
die Sa. von 2850 fl. In den Kauf gehen 10 Stiere, 1
Kuh, 5 Schmalvieh. An Feldstücken sind ca. 26 Morgen vermerkt,
bestehend aus Garten, Wiesen, Acker und Bürgerteile.
Im Nov. 1850 verkauft Michael Hasenmaier
das Hofanwesen Haus 23 - "Schneiderbauer", in der Käfergasse
an seine Tochter Rosina und deren Bräutigam Michael Knödler v. Holz-leuten
für die Sa. von 4500 fl. An Dreingaben gehen: 4 Stiere,
3 Kühe, 3 St. Schmalvieh und 2 Schweine, bei ca . 20 Mrg.
Garten, Wiesen, Acker und Bürgerteile.
Praktisch jeder Seldner und Handwerker oder auch Häusler hatten
mindestens eine Kuh im Stall, im letzteren Falle zumindest 2 oder
3 Ziegen. Die Eigenversorgung mit Milchprodukten war damit gesichert.
Ein Teil der überschüssigen Milchprodukte wurde teilweise jeweils vor Ort gekäsert,
gebuttert und vermarktet oder zum Dorfkäser und Dorfkrämer gebracht.
Es sei an den Namen Becka-Käser, 1854 im Haus 47 - das spät. Radanwesen in der Vorstatt, erinnert, oder
an den "Käser Hirsch"
im Haus 81. Hier
ist vermerkt: "Nach
der Firmung in Hohenstadt am 13. Sept. 1893, abends um ¾ 5 Uhr, kam der hochwürdige Bischof nach Heuchlingen
und wurde am Hause des "Käsers"
Hirsch von der Pfarrgemeinde empfangen".
Wirtschaftlicher
Wandel.
Im letzten Drittel des 19. Jh. setzte auch in unserem Raum eine allmähliche
Industriealisierung ein. 1885 fuhr in Cannstadt das erste Motorrad
und 1868 das erste Auto der Welt. Die Auto-industrie entstand.
1861 fuhr die erste Eisenbahn von Stuttgart nach Aalen. Es
entstanden nun vermehrt Industrie - und industrieähnliche Betriebe
auch in Gmünd und Aalen. Die königlichen Hüttenwerke
in Wasseralfingen standen in voller Blüte. In deren Folge nun
stieg auch die Bevöl-kerung in den Städten (Stgt., Gmünd,
Aalen u.a) kontinuierlich, damit stieg nun auch der Bedarf an Milchprodukten
in den Städten stark. Milch und Milchprodukte wurde zur Mangelware.
Das heißt, die Milcherzeugung musste erhöht, die Milchviehbestände
mussten aufgestockt werden. Dies alles erforderte eine völlig
neue Milchvermarktung. Landauf und landab wurden jetzt in den Dörfern
Molkereien
und Molkereigenossenschaften gegründet.
Die Situation in Heuchlingen
Um 1890 wurde auch in Heuchlingen eine zentrale
Milchabgabestelle, eine Molkerei einge-richtet. Die Zeit der Eigenverwertung
und Vermarktung ging zu Ende. Nun konnte die täglich am Morgen
und am Abend handgemolkene frische Milch, zunächst zur Entrahmung,
später zur Kühlung und Vollmilchabgabe abgeliefert werden.
Ein großer Fortschritt damals und ein nicht geringer, ja wichtiger
Zuverdienst für die Bauern und Landwirte.
..
Das Ende. Der Fortschritt schritt rasch voran. Diese genossenschaftliche
Milchverwertung dauerte dann auch nur knappe 80 Jahre. Diese Art der
Milchvermarktung - Molkereisam-melstellen und
Milchabfuhr, wurde Anfang der 1970er Jahre eingestellt - z.
Tl. auch als eine Folge verschärfter Hygiene-Vorschriften. Dies
bedeutete dann vollends schnell das Aus für den Kleinbauern.
Die größeren Bauern stockten ihre Milchviehbestände
immer mehr auf. Melkroboter kamen zum Einsatz. Im Zweitagerhythmus
holte nun - wohl schon ab mitte der 1970er Jahre, ein Tankfahrzeug
die Milch direkt auf dem Hof des Bauern ab - Milchabholer hierbei
war zuletzt wieder die Fa. Lang von Leinroden. ------ Eine Ära ging zu Ende ----
.....
 Auf
dem Bild Auf
dem Bild
Die 1890 erbaute Molke am Küferbach mit dem
angebauten Maschinenhaus für die Dampfmaschine.
Mit dem hier erzeugten Heißdampf wurde die Milch keimfrei erhitzt,
Zentri-fugen, Rührgeräte u.a. Masch. angetrieben.
Die Dampfmaschine, besser die Dampfkraft, diente außerdem zur Reinigung der Einrichtungen und der Geräte.
Später wurde die Milcherhitzung verboten. Jetzt
mußte sie herunter gekühlt werden - so die Zeitzeugenaussagen.
----- Die Versorgung der neuen " Molke" mit Wasser erfolgte
über eine Rohrleitung vom nahen Badbrunnen weg in das neue Molkehaus.
Wissenswertes hierzu: Um 2012 ließ D. Bopp in seinem
Ziergarten neu gestaltete Blumenbeete anlegen. Dabei kamen alte Leitungsteile
welche vom Badbrunnen weg zur Molke führten zu Tage. Es waren
dies bereits Stahl-(oder Gußrohrteile) Es handelte sich hier
sehr wahrscheinlich um die erste Versorgungsleitung zu "Molke".
Qu. Jos. Ehmann.
Weitere Daten zur Einrichtung
der "Molke":
1892: Schriftverkehr
betr. sofortigen Erledigung des O/A.- Erlasses betr. Prüfung einer
Dampfkesselanlage. Intern:
Es gab wohl eine Vorgängeranlage zum D. Kessel aus 1896.
1896: Prüfbericht zum neuen Dampfkessel, Marke: "Bergedorfer
Eisenwerke Bergedorf" - 1896 - 6 Atm - Nr. 894, beigefügt die Urkunde der Baugenehmigung
v. 30. Okt.1896
.............................
....................
Molkereigenossenschaft in Heuchlingen
Dem Bau der Molke am Käferbach wird sicher die Gründung der
"Molkereigenossenschaft Heuchlingen"
voraus gegangen sein. In dieser Genossenschaft wurde es für die Bauern
jetzt möglich, ihre Milch gemeinsam zu zu verarbeiten und zu vermarkten.
Vorher wurde, wie schon erwähnt, teilweise jeweils vor Ort gekäsert,
gebuttert und vermarktet, oder die Produkte zum Dorfkrämer gebracht.
Die angelieferten Milchmengen in die Molkerei betrugen
- je n. Jahreszeit, 1000 bis 2000 lt am
Tag. (so die Zeitzeugenaussagen v. H. Stegm., A. Knödler u.a.)
Als erster Vorstand wurde Bürgermeister J. E. Stütz. gewählt.
(J. E. Stütz hatte zu der Zeit noch 2- 3 Kühe im Stall - bis i.d.
1930er J.)
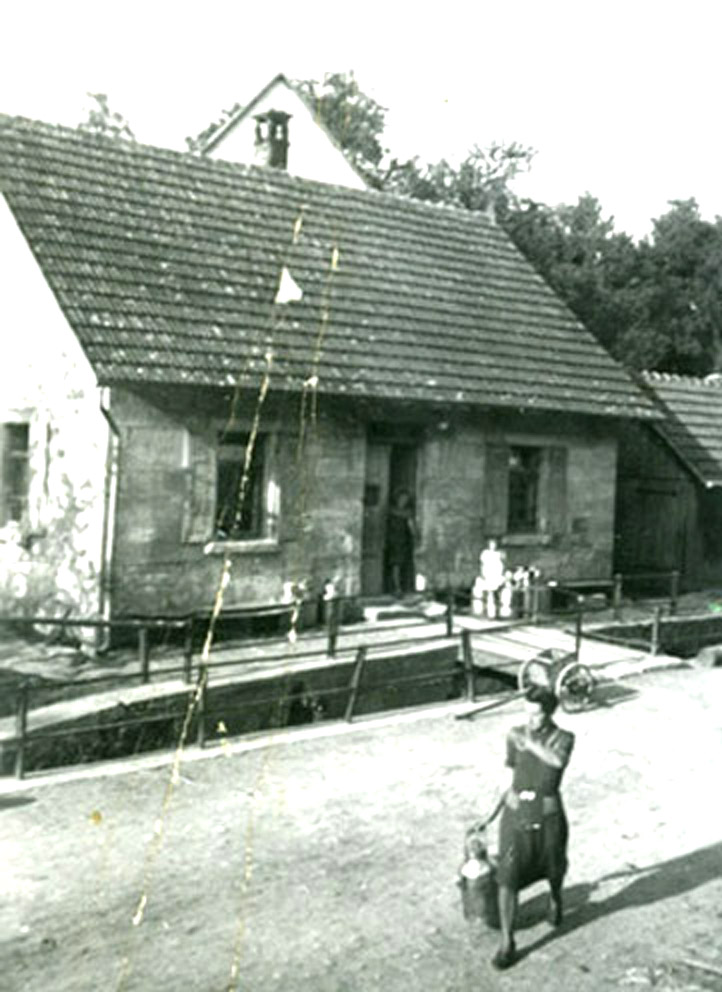
Die "Molke" am Käferbach
um 1948.
Der Molke - Türstein - Schlußstein

.
Die Milchabfuhr in
Heuchlingen
Mit dem Bau des Milchwerkes
in Schw. Gmünd wurde es möglich, von der entrahmten Milch den überschüssigen
Rahm, u. dann die Milch selbst, in dieses Milchwerk abzuliefern.
Hierzu wurde zu Anfang wurde nur der *Rahm,
später dann die gekühlte Vollmilch in 40- Literkannen nach Mögglingen
zur Bahnstation gefahren *Die entrahmte Magermilch ging als Viehtränke aber auch als Nahrungsmittel
zurück an die Milchlieferanten und Dorfbewohner.
Der erste Milchfahrer war der Munzawägner.
Er hatte ein "Berner-Wägele und a Gäule" - so
Bruno Schierle. Auf diesen "Bernerwagen" nun wurde der mit
der Zentrifuge gewonnenen Rahm geladen und zur Bahnstation nach Mögglingen - und zum Weitertransport nach Gmünd gefahren.
Als zweiter Transporteur wirkte Josef Grimminger, der Schreiners
Seff. Dieser fuhr - die jetzt nicht mehr entrahmte Milch, dann
schon in genormten Kannen mit einem Pferdegespann zur Bahnstation
und nahm im Gegenzug die vom Milchwerk Gmünd angefahrenen leeren
Kannen zurück.
Mit dem Aufkommen von Lastwagen ging diese Transportära dann zu
Ende. Die Milch wurde mit dem LKW jetzt direkt von der "Molke"
zum Milchwerk nach Schwäb. Gmünd gefahren.
Erster LKW- Transporteur
wurde in den 1930er- Jahren der Theodor Lang v. Leinroden, allgemein
nur der Rahm- Melker - schwäbisch "Raumelker",
genannt. (Bruno Sch. , Jg.1926, erinnert sich als kleiner Bub mit
5 oder 6 Jahren zurück an die ersten Erscheinen des Molkelastwagen
Lang mit seinem niederen Pritschenaufbau.)
.......
Bei einer Neuvergabe
in den 50er-Nachkriegsjahren gab auch Eugen Schmied v. Hchl. um einen
Transportzuschlag ein, kam mit seinem Angebot aber nicht zum
Zug.
Angemerkt: Eugen Schmied hatte einen eigenen Lkw und erbrachte
allerlei Transportleistungen, wie sie in der Nachkriegs -u. Aufbauzeit erforderlich
waren. (Fabrikgüter, Steinfuhren usw.) Später war E. S. dann Werkstattangestellter,
Warenausfahrer und Cheffahrer bei Spießhofer in Heubach.
Der Transportzuschlag ging jetzt (unter Vorbeh.) an die Fa Kochendörfer
v. Mögglingen. (in die Fa. Kochendörfer heiratete später
ein "Lang" ein- Kochendörfer wurde z. Fa. "Lang")
....
Die letzte Fahrt: Um
1970 wurde der Molkereibetrieb in Heuchlingen eingestellt.
Hierzu
kann vielleicht noch erwähnt werden: mit dem Einsatz der Tankfahrzeuge
und auch durch verschärfte Hygiene- Vorschriften wurde in den
letzten Jahren des Molkereibetriebs die Milch in einer ca. 3000 lt
Wanne in der "Molke" herabgekühlt gesammelt und vom
Tankwagen zum Weitertransport abgesaugt.
Nach dem endgültigen
Aus wurde die Milch - einige Jahre lang, von den Milchbauern in
fahrbaren Kühlkannen gelagert und einmal am Tag an einen Sammelplatz
gefahren, wo die Milch dann vom Tankfahrzeug abgepumpt wurde. Danach
wiederum wurde die Milch direkt beim Erzeuger abgeholt - wie weiter
oben schon erwähnt.
..............
Um
1975 / 76 geht die Molkerei in den
Besitz von Josef Ehmann über. Zunächst wurde das Gebäude
eine Zeitlang als Wohnung genutzt. Heute ist sie zur Garage umgebaut.
.......
Die Vorstände der Molkereigenossenschaft
in Heuchlingen: Qu.: Anton Knödler und Franz Vogt nach mündlichen
Überlieferungen.
1. Johannes Ev. Stütz, Bauer, Postagent und Schultheiß. -Gründungs
- Vorstand- (n. A. Knödler)
2. Anton Wöller "Dürrenbauer"(s. Unterschrift a. Seite 3)
3. Ludwig Knödler, "Schneidersbauer". || Rechner: Röhrle
Johannes.(u.a.)
4. Georg Knödler, "Schneiderbauer"
5. Hugo Vogt, "Zergenschwarz"
6. Franz Schwarz, "Pfeard`s Franz"
Die
Molkehalter am Küferbach in Heuchlingen :
1. Johannes Stäb, "der alte Molker" und Hans Stäb, Molkereiwärter.
Hausname: "Molkers"
2. Waibel Fritz. = " Kauza Fritz"
3. Waidmann Xaver. = "Keartwilhelma Xaver"
4. Hägele Anton. = " Grießers Done"-
5. Steeb Stefani, Ehefrau v. Anton Steeb, Wagner
u. Postzusteller.
....................................
Ende
der Dampfära - Akte vom 15. Dezember 1903:
Die " Centrifugen - Molkerei - Genossenschaft - Heuchlingen"
meldet betreff Einstellung der regelmäßigen Revisionen, an den "Württemb.
Dampfkessel - Revisionsverein" in Stuttg.
die Stillegung und d. Verkauf der Dampfkesselanlage. Die "Dampfbetrieb
- Maschine" wurde nach Stuttgart verkauft. --- Qu.
St. Arch. Ludw.burg.
............................
.
Die
Molkerei in Heuchlingen
- ein Haus-Schnitt aus dem Jahr 1896
siehe
nachsteh. Darstellung
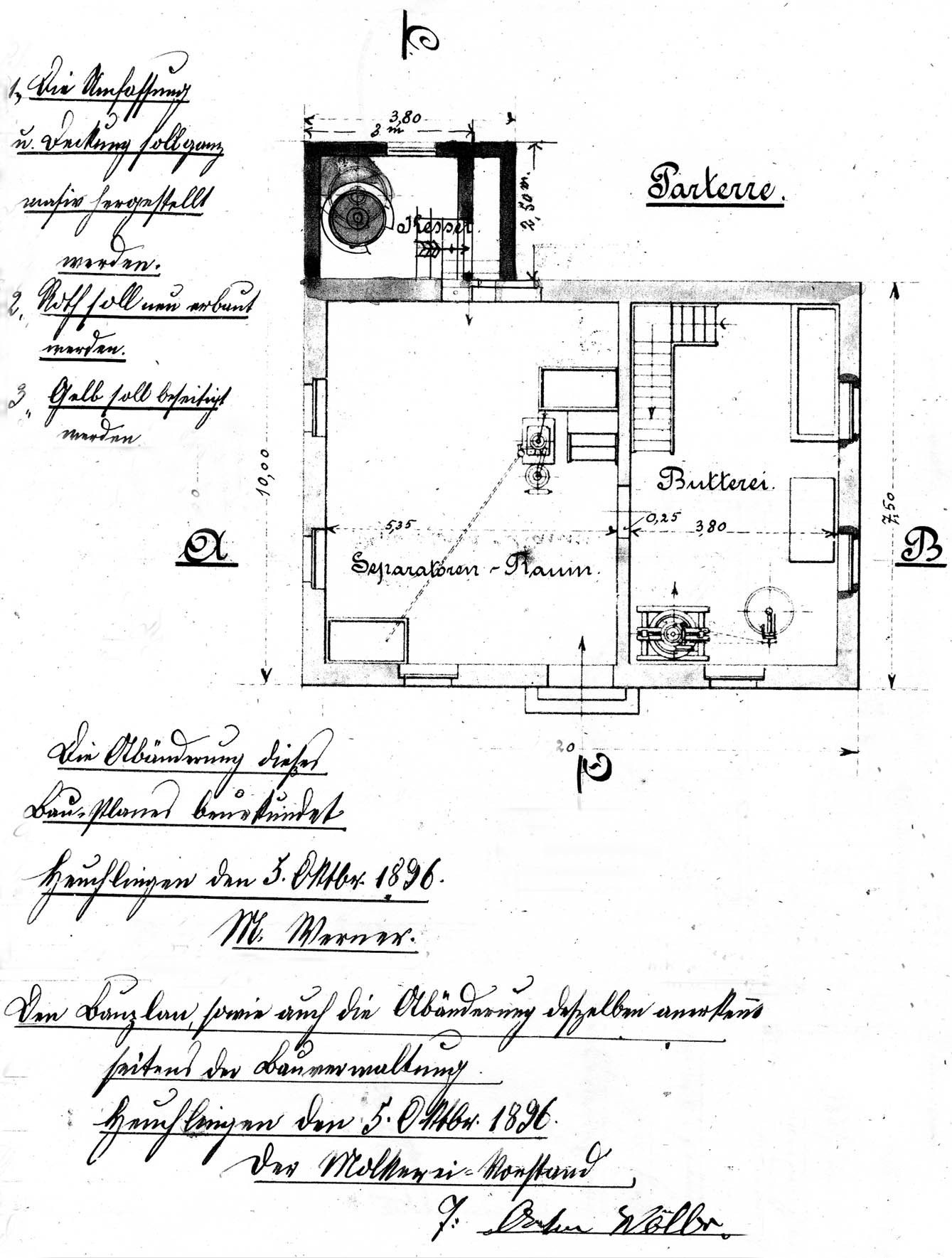
Wissenswertes
zum Thema Molkereigenossenschaften.
Beispielhaft hier die Verhältnisse in Eschach
- s. nachsteh.
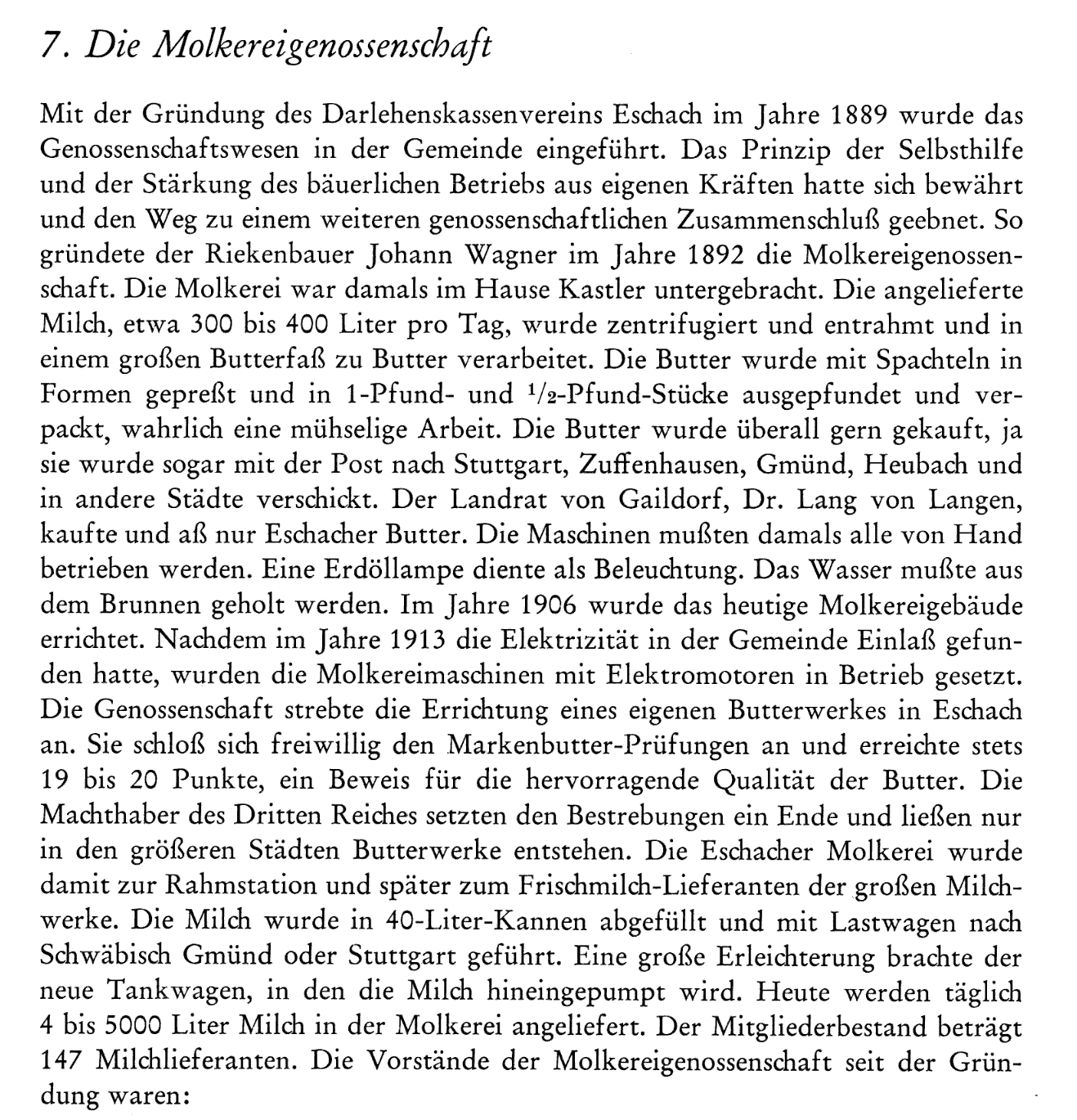
.
.
Rücknavigation
- zur Beachtung
zurück z.
Areal 1
- wenn von Areal Küferbach
kommend
oder
zurück zu Navigation 4 - wenn von Navigation
4 kommend
|
 Auf
dem Bild
Auf
dem Bild