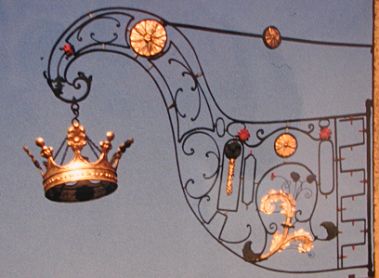|
Das Gasthaus - Auszug aus "Gasthäusern
in Waldstetten" v. H Blessing.
.......
Gemeinsame Grundlage für die Entstehung der Gasthäuser war das
Erzeugen von Bier, Wein, Most, Branntwein u. dgl., um das Bedürfnis
der (männl) Bevölkerung nach Unterhaltung,
Alkoholgenuß und die Beherbergung von Reisenden, verbunden mit
der Ausgabe von Speisen, zu befriedigen.
Ebenso
waren die größeren Gasthäuser wohl schon immer auch ein Versammlungsort
für freudige und traurige Anlässe
So finden wir das Gasthaus oft direkt neben, oder in der Nähe
der Kirche, an alten Posthaltestellen und an Handelswegen.
Für
die Herstellung und den Verkauf von Bier bedurfte es der vom Grundherrn
(Fürst, Graf, Kloster usw.) verliehenen Braugerechtigkeit, da die zum
Brauen benötigten Pflanzen, wie Gerste Weizen, Hopfen und Gewürze auf
seinem Grund wuchsen. Diese "Grutrechte" - Grut = Korn, hatten bis ins 15. Jh. Gültigkeit.
Wirtshausordnung
Im 16 Jh. erließen die deutschen
Fürsten dann auch eine Wirtshausodnung, in
welcher all die Vorschriften und Verordnungen hinsichtlich Maße und
Gewichte, die Vergabe einer Konzession, Steuern und Abgaben festgelegt
waren. Dafür wurden Steuerschätzer, bzw. Steuereintreiber, sogenannte
Umgelter oder Visierer,
eingesetzt. Hierbei war auch der Status des Gasthauses und die damit verbundenen
Rechte festgelegt.
Die Taverne
oder Taffernwirtschaft hatte das Recht, Getränke und Speisen auszugeben
und Fremde übernachten zu lassen. Sie hatte ebenso das Recht ein Schild
auszuhängen. Daraus entwickelte sich der Begriff "Schildwirtschaft".
Dabei waren die Rechte sehr eng gefaßt. So
heißt es z.B.: gekochte Speisen dürfen nur zu den Hauptmahlzeiten vorgesetzt
werden, ausgenommen sind: " über Land raisende
Priester", damit sie ungesäumt ihren Sachen nachkommen können.
Schankwirtschaften
durften dagegen nur Getränke ausschenken. Diese findet man auch unter
der Bezeichnung "Gassenwirtschaft", oder auch "Pfeifenwirtschaft"
(Rose, bzw. Hirsch i. Waldstetten.)
Besenwirtschaften
durften nur zu genau festgelegten Zeiten Getränke, meist Wein, oder
Most, verkaufen.
………………….
Wirtshausnamen
im Wandel der Zeit – und Symbole der Gastfreundschaft
Gekürzter
Auszug aus "Deutschsschweitzer
Wirtshausnamen -September 2005 von Maurus
Ebneter (ebneter@baizer.ch) Qu.: aus Google
Wir haben uns daran gewöhnt,
dass Restaurants fremdländische Namen wie Taj Mahal, Miss
Saigon oder Akropolis tragen. Doch wie heißen eigentlich
die typischen alten Deutsch-Schweizer "Wirtscaften" - "Beizen"
?
Ursprünglich
waren Gasthäuser mit Büschen und Kränzen gekennzeichnet. Bei einfachen
Landschenken und "Straußenwirtschaften" hat sich das teilweise
gehalten.
In
den Städten setzten sich bereits ab dem 13. Jahrhundert Namen und
Schilder durch. Als Wirtshausbezeichnung weit verbreitet sind Wappentiere
wie Adler, Löwen und Bären, außerdem christliche
Schöpfungssymbole wie Ochsen, Pferd (Rößle), Lamm
, und Storchen.
Namen und Symbole
spielteneine große Rolle
Die
"Sonne als
Spenderin von Licht, der "Stern als Glücksbringer, die „Krone
als Sinnbild von Macht und die "Rose als altes Marienzeichen,
daneben auch Heiligenattribute wie "Anker, "Schlüssel,
"Schwert oder "Pflug. In der Region Basel darf natürlich
der "Stab nicht fehlen!
Den
"Salmen"
gibt es immer noch, auch wenn der Lachs bei uns ausgestorben ist. In
anderen Gegenden sind Gasthäuser eher nach "Hecht und "Forelle
benannt. Der biblische Walfisch konnte sich nicht etablieren.
Der
Adler. Seinen
Platz als König der Lüfte macht dem "Adler" auch als
Gasthausnamen kein anderer Vogel streitig: Weder "Falken noch
"Sperber, weder "Raben noch "Spatz, weder "Schwanen
noch "Taube, schon gar nicht "Strauß und "Pfauen.
An Wildtieren kommen "Hirsch,
"Steinbock, "Gemsli und" Widder
vor (im solothurnischen Bezirk Thierstein
heißen sogar drei Restaurants "Reh"). Mit Jagd- und
Schiessleidenschaft sind "Jägerstübli,
"Schützenhaus und "Fischerstube zu erklären.
Bahnhof und Post befinden sich unter
den Top Ten: Wo Publikumsverkehr herrscht,
dauert es eben nie lange, bis ein Lokal aufgeht.
Analoge
Entstehung ist bei "Station -"Central, "Eisenbahn,
"Schiff, "Kreuzstraße, "Scheidweg
und "Wegweiser anzunehmen.
Auch
"Mühle, "Waage, "Brücke, "Schmitte,"
"Säge und "Rathaus verdanken ihre Existenz vor allem der
Gästefrequenz.
Der
"Alte Zoll"
erinnert daran, dass unsere Grenzen nicht immer so verliefen wie heute.
Bäume. Zu einem stattlichen Gasthof gehören
schattenspendende Bäume: Daran erinnern nicht nur "Linde,
sondern auch "Tanne, "Erle, "Ahorn, "Arve
und "Kastanienbaum, ausserdem Bezeichnungen wie "Baumgarten, "Platanenhof
und "Waldegg.
Blumen. Viele Namen sind im wahrsten Sinne blumig - neben "Rose"
(auch in Varianten wie Rosengarten) und "Blume" je nach
Lage auch "Seerose, "Edelweiß, "Alpenrösli und "Enzian.
Umgebung. Unsere Gebirgswelt übte einen grossen Einfluß auf Gasthausnamen aus: "Alpenblick,
"Alpenhof, "Alpina
oder "Jura belegen dies genauso wie" Säntis,"
Rigiblick, "Gotthard, "Bernina oder "Simplon. "Bellavista,
"Belvedere und"Panorama
u.a.
Religiöse Hinweise. Die Namen von Kirchenpatronen
sowie religiöse Bezeichnungen wie "Engel und "Drei Könige
waren schon früh gebräuchlich. Im 19. Jahrhundert setzten sich dann
vermehrt patriotische Namen durch - vom "Weißen Kreuz, zu den
"Drei Eidgenossen, von "Rätia
bis "Baselstab usw.
Tugenden. Auch
bürgerliche Tugenden (Frieden, Freiheit, Frohsinn, Harmonie)
und Begriffe aus der Arbeiterbewegung (Eintracht, Concordia, Grütli,
Volkshaus, Union) kamen in Mode. Manche Restaurantnamen lassen erahnen,
wer dort ursprünglich vor allem verkehrte (Buurestübli,
Färberstube, Güterhalle, Kutscherhalle, Militärgarten).
……………………..
Wirtshausschilder
in Bayern - Kunst und Kultur
Eine Fotosammlung von Manfred
P. Hassel - Heimatmuseum Rain

Gasthaus zur Post, Pleß
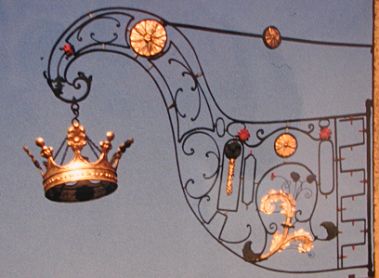
Gasthaus zur Krone, Türkheim
Griechen und Römer kennzeichneten bereits Herberge,
Schenken, Tavernen und Logierhäuser durch auffallende und allgemein
verständliche Bildzeichen auf der Hauswand.
Um 800
wies Karl der Große durch eine Verordnung seine Gutsverwaltungen an,
sogenannte "Strauß-Wirtschaften" zu betreiben. Hier sollte der
mindere Wein an die Bevölkerung ausgeschenkt werden. Kennzeichen für diese
Lokale war ein Strauß oder Kranz, meist aus frischem Grün, an der Hauswand,
oder einer Stange herausgehängt. Das "Aushängeschild" war geboren.
Hauszeichen und Symbole der Wirtshäuser wurden von nun an als
beidseitig besticktes Banner oder bemaltes Schild an Stangen ausgehängt. Auch
der Handel, das Handwerk und das übrige Gewerbe nutzten diese
Werbemöglichkeit.
Im 15. Jahrhundert entstand die Grundkonstruktion des "Auslegers".
Der Tragarm mit Stütze, daran das Bildsymbol.
Qu.: aus Google - gekürzter Auszug aus: Wirtshausschilder in Bayern.
zurück
zu Teil- Navigation 4

|