|
Heuchlingen, ein Verkehrsknotenpunkt an der Lein ohne
Verkehrsanschluss - .......................................... Im März 1553 erschien in Stuttgart eine
Kanzleiordnung, wonach bei der Kanzlei ein eigener Botenmeister aufgestellt
werden musste. Unter Herzog Friedrich I. (1593-1608) wurde das Postwesen
fest organisiert, indem er bestimmte Botenkurse für Fußgänger und
zu Pferd mit regelmäßigen Abgangs- und Ankunftszeiten eingeführt hatte.
Eine dieser Postkurse führte über das Remstal von Stuttgart, Schorndorf,
Mögglingen, Aalen, weiter über Ellwangen nach Nürnberg. Ein weiterer
zweigte von Mögglingen ab nach Heuchlingen und führte weiter
über Abtsgmünd wiederum nach Ellwangen. Auf diesen Kursen befanden
sich mit Hauptboten besetzte Stationen, u. a. in Schorndorf, Gmünd
und Heuchlingen im Leintal. Die von Stuttgart aus nach diesen
Stationen bestimmten Briefe und Sachen wurden an die dortigen Boten
zur Bestellung abgegeben. Namentlich der Heuchlinger
Bote scheint einen großen Bestellbezirk gehabt zu haben, wie seine
Abrechnung mit dem Stuttgarter Botenmeister vom Jahr 1584 ergibt.
Die Stelle soll damals bedeutender gewesen sein als Schw. Gmünd. Der
Bote erhielt, nebst Sommer- u. Winterkleidung, 20 Gulden, 6 Malter
Korn u. 12 Scheffel Haber. Ein interessanter Vermerk hierzu: "Zur
Abstellung von Saumseligkeiten ind der Beförderung der herzogl. Briefschaften,
die dem Heuchlinger Boten zur Last fielen, ihn der Graf v. Rechberg
einige Tage (1583) einsperren ließ" Das Postwappen
war der Reichsadler. So waren die meisten Gasthäuser "zum Adler"
zugleich Poststationen - wie auch unser "Adler".
Im EG befanden sich die Stallungen, Lager und die Poststelle und im
oberen Stock die Gast - und Beherbergungsräume. Diese Details finden sich im Pfarrarchiv Hchl., Krt. 37 - erforscht im Stadtarchiv Schw. Gmünd. (ehedem nur "Gmünd") ......... Trotz der Bedeutung der Poststation
Heuchlingen, gab
es über fast 300 Jahre hinweg keinerlei Anstrengung zur Schaffung einer
annähernd vernünftigen Wege - oder Straßen-anbindung an die
Haupt-Verkehrsachse Stuttgart, Aalen, Nürnberg. Die gesetzten (vorgeschrieb.)
Wegverbindung nach Mögglingen führte über die „Alte
Möggl. Str.“ , bzw. von Möggl. aus über den„Heuchlinger Weg“, und nach Böbingen
über den Brackwang und die Gratwohlhöfe. Die
"alte Mögglinger Staße" zeigte sich als ein mit groben
Bruchsteinen befestigter holpriger
Hohlweg, mit steilen Anstiegen und Gefällstrecken. Lastfuhren über diese
Stecken waren mühsam und oft nur mit Vorggespannen
möglich. Ähnliches gilt für die Verbindung nach Schechingen und weiter nach
Hohenstadt. Der Weg nach Böbingen führte ebenso über weitgehend unbefestigte
Feldwege die oft - je nach Jahreszeit, als grundlos und unbefahrbar
beschrieben werden. Eine direkte Verbindung im Tal, entlang der Lein, nach Laubach und Abtsgmünd oder nach
Leinzell, gab es noch nicht. In Heuchlingen selbst musste die Lein noch über
eine Furt gequert werden - dabei war die Querung im Winter und Frühjahr oft
nicht möglich. Erst 1680 wurde
dann die erste hölzerne Brücke über die Lein gebaut, die wiederunm
viele Male vom jährlichen Hochwasser weggeschwemmt oder beschädigt wurde, bis 1777 dann eine Steinbrücke erstellt
wurde. 1872 wurde die Steinbrücke
von einer Brücke in Eisenkonstruktion ersetzt -die 1945 dann unter der Last
eines amerikanischen Panzers zusammenbrach.)
...................... ...............
.................. Bau neuer Ortsverbindungsstraßen nach Mögglingen, Schechingen, Laubach, und später
nach Leinzell -- eine Ergänzung
zum Glosse: "Politik und Straßenbau" Wir erinnern uns: Die neue Straße nach Mögglingen sollte gebaut
werden. Geplant war sie schon längere Zeit. Der hiefür verantwortliche
Abgeordnete für den Bezirk Aalen benützte - es war in etwa im Jahr 1860,
dieses Bauprojekt als Wahlspeck für die Wähler in Heuchlingen. Er
versprach den Heuchlingern, dass er sich tatkräftig
dafür einsetzen werde, dass die Mögglinger Strasse gebaut werde in aller
Bälde. Das tat seine Wirkung. Die Heuchlinger wählten ihn geschlossen. Die
Wahl war vorüber - aber es blieb alles beim Alten. Die Strasse wurde
nicht gebaut in den 6 Jahren. Da geschah dann die in der Glosse beschriebene Geschichte.‘ Offenbar setzte sich in den zuständigen Regierungskreisen dann doch allmählich
die Erkenntnis durch, dass bei der fortschreitenden Industrialisierung-
auch in Württemberg, die verkehrstechnischen Zustände, besonders an
den Rändern des Landes, nicht mehr tragbar waren, und dringend gehandelt
werden musste. Zumal ja mittlerweile im Jahr 1861 in Mögglingen am dortigen
Bahnhof schon der erste Dampfzug auf der Strecke Stuttgart – Aalen
Halt machte. Bau
der „Neuen Mögglingerstraße“ ...................... Straßenbau nach Schechingen Für
die Wegführung und den Bau der Schechinger
Straße wurden im Prinzip die schon vorhandene, gesetzte, Wegführung
nach Schechingen und Hohenstadt genutzt: also, am Ortsende schräg
hoch in Richtg. Nordost, im scharfen Linksbogen
weiter hoch Richtung West unter dem Lettenrain, dann
wiederum im leichten rechten Bogen über den Letten zum Riedhof,
am Riedhof vorbei geradewegs über 3 Feldrücken
weiter n. Schechingen. In der
Geschichte "Schechingen" in 1862 ist hierzu vermerkt:
"Eine Vizinalstraße führt von Schechingen nach Hohenstadt und
Heuchlingen" (und zwei weniger frequente Sträßchen über Horn
nach U.böbingen und über Göggingen nach Leinzell.) Die ersten
Vermessungspläne für einzelne Straßenabschnitte sind datiert auf
1868/69. Auch
hier gilt: Über die gesamte Dauer
des Straßenbaues nach Schechingen und die Art der Straße: Schotter - oder auch Makadamstraße,
ist derzeit kein Wissen vorhanden. Qu.: "Geo-Info
und Landesentwicklung" - Landratsamt Aalen, Gartenstraße 97-
Quadrat 1, u.PC-Ablage (2 Detailpläne). ………………………. Neue
Straße nach Laubach Weiter oben wurde
es schon erwähnt. **Der Weg dorthin führte
über ausgesteinte Feldwege,
mühevoll, entweder über den Schl0ßberg oder in Richtung Holzleuten
links ab steil hoch zur Röth und von dort weiter in Richtung Laubach
über die dortige Schloßsteige.
Über
die Notwendigkeit einer Verbindungsstraße im Tal nach Laubach
und weiter nach Abtsgmünd, konnte also keinen
Zweifel bestehen. Die ersten Vermessungspläne für die einzelnen Straßenbauabschnitte sind dann auf 1870/71 datiert. 1870/71 kann als Erbauungsdatum für die Laubacher Straße angenommen werden..
.
. Laubacherstraße Abschnitt
……………………… Bau der Leinzeller
Straße. Auch für die Leinzellerstraße gilt: Einen direkten Verbindungsweg nach Leinzell im Leintal gab es bis zum Ende des 19. Jh. nicht. Der Weg dorthin führte über den Kirchbühl steil hoch zum "Häfner", links abzweigend weiter nach Horn. Von Horn hinunter in das Leintal und weiter nach Mulfingen u. Leinzell -- Alternativ über den Kirchbühl an der Schule und Haus Waidmann vorbei, garade weiter auf dem Feldweg 9 die Bilzwiesen unter dem Schwerzlingsrain querend, über den Schinderbach zum Schinderhaus und weiter nach Horn. -- Eine dritte Alternative führte durch das Leintal bis ca. 150 m nach dem "Altwasser". Von dort führte ein Feldweg schräg hoch über die Bilzwiesen. Dort mündete der Weg dann nach dem Schwerzlingsrain in den vor beschriebenen Weg. Alle drei Wegführungen, eine mühsame Angelegenheit.
Als Datum für den Baubeginn kann das Jahr 1900 angenommen werden...
Bereits im Juli
1902 erfolgte dann die Abnahme der abgeschlossenen
Straßenbaumaßnahme durch das zuständigen Bauamt. Beanstandet wurde, man beachte, erste Hebungen an der neuen Straße und
Schiebungen durch nachdrückenden Knollenmergel. Sofortmaßnahmen wurden aber
noch nicht festgelegt. Es sollte die Beruhigung der umliegenden Bau-u.
Grabzonen abgewartet werden. Noch offen bei dieser Abnahme waren diverse
Entwässerungs- und Bösch-ungsarbeiten, das Setzen von Akazien entlang
der Straße u.a.
. . Leinzeller – Straße. Abschnitt im Bereich der heutigen Firma Klingenmaier. . .
Wissenswertes
zur Leinzeller Straße: Beim Bau
der Straße nach Leinzell waren 74 Italiener beschäftigt. Die Italiener
galten damals als die Spezialisten im
Bahn -Straßen - und Tunnelbau. Sie waren bei zahlreichen Verkehrsbauten
im Land im Einsatz. (von 1890 - 1914 kamen über 1 Million Italiener
zur Arbeit nach Deutschland) Einige dieser Gastarbeiter wurden hier
sesshaft. Ihre Namen existieren noch heute: so z.B. die Straßenbaufirmen
Bortolazzi und Rossaro oder die Fam. Petrogalli
in Schechingen und Hchl. 1952 wurde die erste Busverbindung-Untergröningen /Abtsgmünd nach Schwäbisch Gmünd über Heuchlingen und
Leinzell eingerichtet. Diese Busse
fuhren die ersten Jahr noch über diese ungeteerte
"Makadamstraße". Im Frühjahr war die
Straße ausgewaschen und mit tiefen Schlaglöchern versehen. Schäden wurden mit
lose aufgeschüttetem Schotter nur notdürftig behoben. Auch war die Straße
insgesamt sehr schmal und mit zu schwachem Unterbau versehen und für den
zunehmenden Verkehr an Pkw, Bussen und LKW
nicht mehr geeignet - Busse un LKW`s konnten nur im Schritttempo
aneinander vorbeifahren. Im Juni 1952 wurde die Behebung dieser unhaltbaren
Zustände beim Strassenbauamt Schorndorf als sehr dringend angemahnt und dabei
auf die hohen Verkehrsgefahren hingewisen, bis dann um 1955/56 die größten
Schaden - und Gefahrenquellen beseitigt und eine Teerdecke auf den Belag
aufgebracht wurde. Im
letzten Viertel des 20. Jh. erfolgte dann eine Erneuerung der Leinzeller
Straße. Sie wurde neu ausgehoben, verbreitert und nach dem damaligen Stand
der Technik gebaut. Jedoch auch dieser
neue Straßenbau war den Schub – und Hebekräften des
vorherrschenden Knollenmergel nicht gewachsen. Im 2. Jahrzehnt des 21.
Jh. mussten Teile der Leinzeller Straße im Bereich unweit vom Ortsende Hchl. bis nach der
2. Hornauffahrt aufwendig erneuert werden - bis heute, 2017, ein
gelungnes Werk. ............ Wissenswertes zum
Begriff Makadam. Der von John Loudon
McAdam, einem schottischen Ingenieur, in
den frühen Jahren des 19. Jahrhunderts entwickelte Straßenaufbau bestand
aus drei Lagen Schotter von unterschiedlicher Körnung, die auf einer
gewölbten Grundfläche aufgebracht wurden, mit seitlichen Gräben zur
Drainage. Die untersten beiden Lagen . Mit
dem Aufkommen von Motorfahrzeugen wurde Staub ein ernsthaftes Problem
für Makadam-Straßen.
Der Unterdruck unter schnell fahrenden Fahrzeugen saugte den Staub
und feine Sandpartikel aus der Ober-fläche, was dazu führte, dass
auch die gröberen Partikel ihre Verbindung verloren. Außerdem entstanden
unangenehme Staubwolken. ..
|


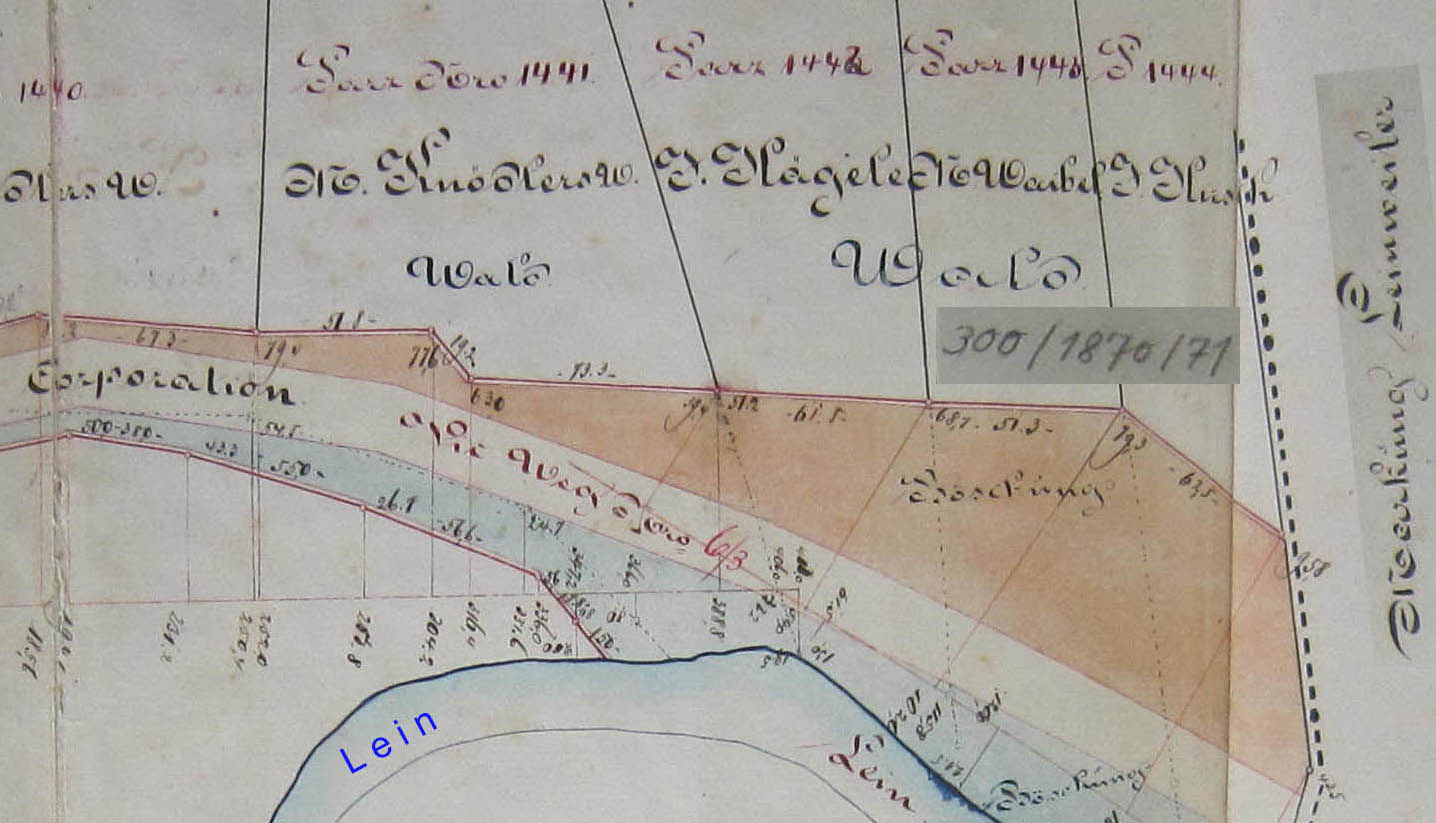
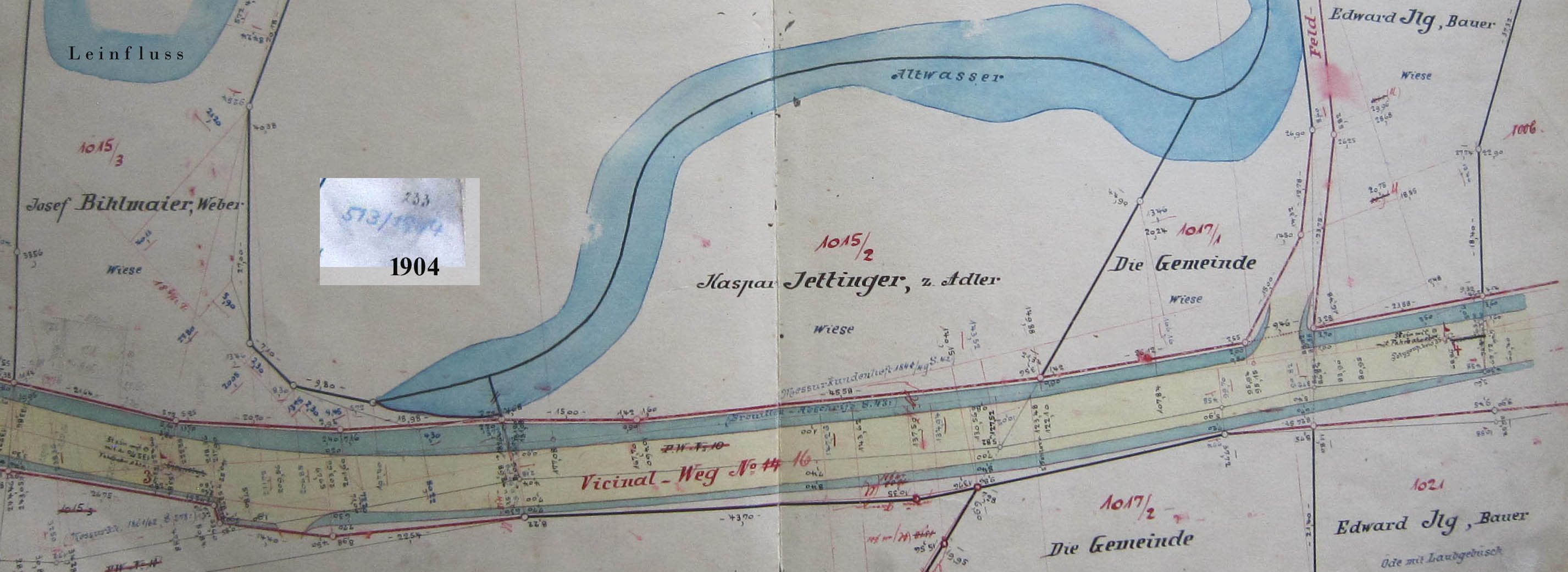
 bestanden aus Schotter (handgebrochen,
Korngröße bis zu 8 cm) in einer Gesamtdicke von 20 cm, darauf
wurde dann eine Lage Splitt (Korngröße bis 2,5 cm) in einer Dicke
von 5 cm aufgebracht. Die Lagen wurden jeweils einzeln mit einer
schweren Walze verdichtet. Dies sorgte dafür, dass sich die kantigen
Granulate ineinander verkeilten. Diese Grundkonstruktion wird oftmals
auch wassergebundener Makadam genannt. Die Methode war zwar
sehr arbeits-intensiv, erzielte aber einen festen und selbstentwässern-den
Straßenbelag. Derart befestigte Straßen wurden als makadamisiert
bezeichnet.
bestanden aus Schotter (handgebrochen,
Korngröße bis zu 8 cm) in einer Gesamtdicke von 20 cm, darauf
wurde dann eine Lage Splitt (Korngröße bis 2,5 cm) in einer Dicke
von 5 cm aufgebracht. Die Lagen wurden jeweils einzeln mit einer
schweren Walze verdichtet. Dies sorgte dafür, dass sich die kantigen
Granulate ineinander verkeilten. Diese Grundkonstruktion wird oftmals
auch wassergebundener Makadam genannt. Die Methode war zwar
sehr arbeits-intensiv, erzielte aber einen festen und selbstentwässern-den
Straßenbelag. Derart befestigte Straßen wurden als makadamisiert
bezeichnet.