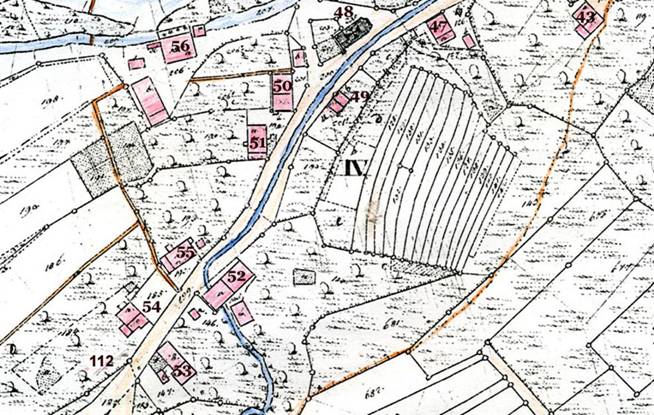Vom
Urbarium zum Catastrum - oder Steuerbuch in Württemberg -
Aus 150 Jahre Wttb. Landesvermessung
...............................
Ähnlichen Zwecken
dienten vorher das sogenannte Urbarium oder Zinsbuch- Zinsrodel.
Stückvermessungen
1713 wurden die Gemeinden und Städte im Herzogtum
Württemberg wiederum angewiesen, den gesamten Grund und Boden und Gebäude
zu erfassen und in Kataster-oder Register festzuhalten.
Ziel dabei war, die vergebenen und einzelne Lehen durch eine Vermessung
zu erfassen. Dabei mussten geschworene (vereidigte) Untergänger,
also ortskundigen Bauern und Bewohner,
die Grenzen der zu vermessenden Grundstücken abmarken. Dazu wurden Feldstücke mit eichenen Pfosten markiert und
die Abstände abgeschritten. Es war eine einfache Vermessung, ohne
örtlichen Zusammenhang- z.B. Lage zum Nachbargrund. Sie diente allein
zur Flächenermittlung der nutzbaren Besitzstücke. Ödland, ungerade Weiden, Raine, Buschwälder, Wege und Bäche wurden
nicht vermessen.
Im Grund wurde hier also festgehalten: wie viel
Morgen Wiesen, Äcker und Garten hatte der einzelne Lehner oder Bauer.
..............................
Landesvermessung -
Württemberg wird neu ausgemessen
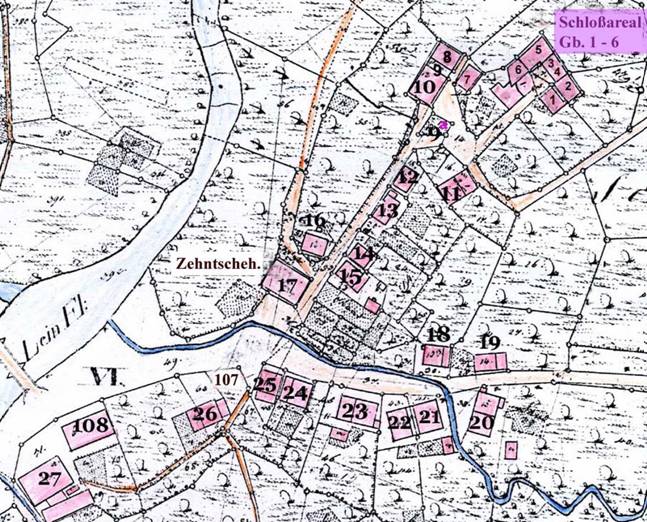
Abbildung oben: PlanUrnummernkarte Heuchlingen - Schlossgasse – Küfergasse
Von 1818 bis 1840 wurde das gesamte Land Württemberg neu vermessen. Fundamentalpunkt oder Ausgangspunkt der Vermessung war das Schloss Hohentübingen. Heuchlingen wurde dann um 1830 / 34 erreicht. Die Vermessungstätigkeit dauerte dann wohl mehrere Jahre (1840)
Dabei wurde jede Wiesen - und Ackerparzelle, jeder Hausgarten, jede Hütte, jedes Haus und jeder Weg und Bach nach Lage und Fläche vermessen – und mit fortlaufenden Nummern versehen. Das Ergebnis fand seinen Eintrag dann in den Urkarten und im sogenannten Primärkataster. So eine Urkarte sehen wir vor uns.
Eine solche Beschreibungsmethode
führte vielleicht schon nach 1, spätest nach 2 Generationen, bei
einer notwend. Recherche zu Problemen
Sie beginnen mit der Nr. 1 am Schloss, führen dann rechts
– und links die Schlossgasse hinunter, links die Küfergasse entlang und
an der rechten Seite wieder zurück
zur Alten Mögglinger Strasse / Gänsbühl. Weiter zur Vorstadt danach ins
Dorf, links der Lein, usw.
.