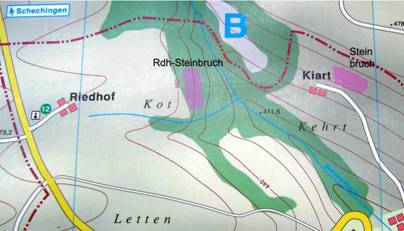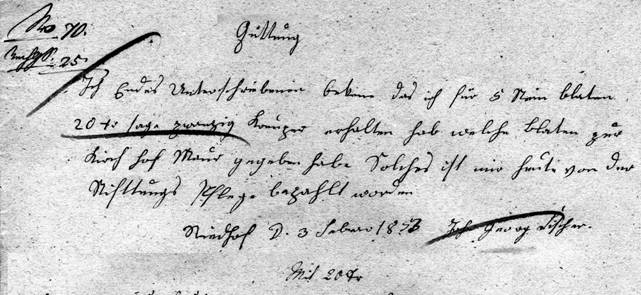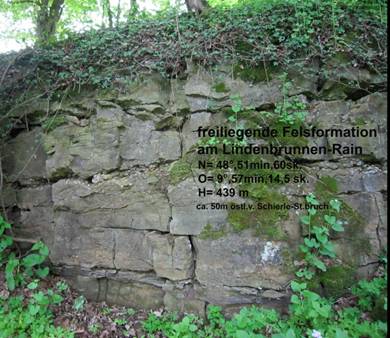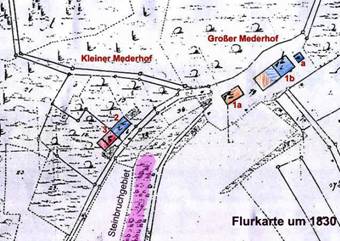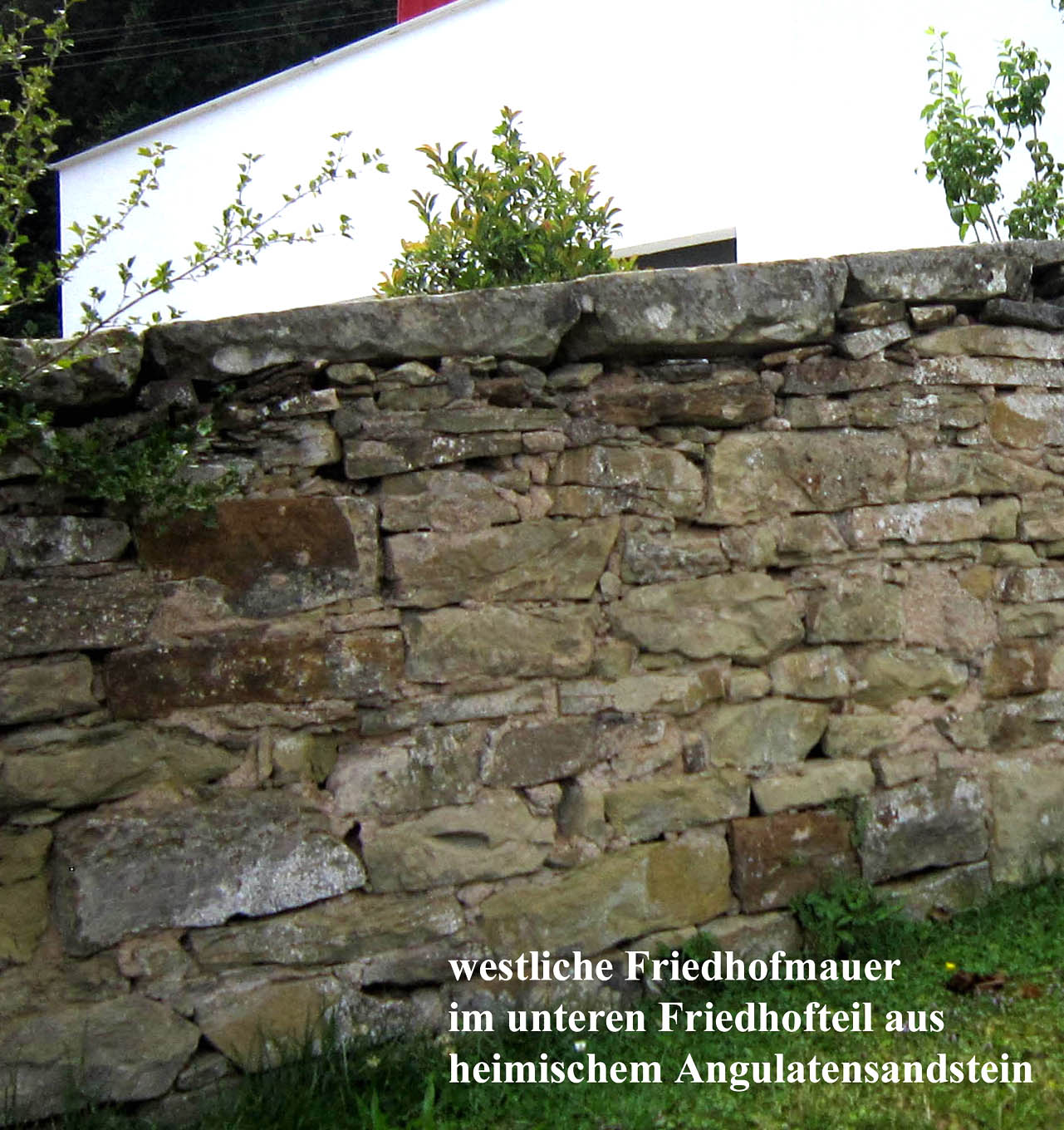|
Steinbrüche
in Heuchlingen „A stoinigs Äckerle“ findet sich nicht nur auf der
Schwäbischen Alb. Auch an den Hängen und Anhöhen des Leintales sind
sie zahlreich und oft eine Mühsal
für Mensch und Tier und Maschinen- bis heute. Legenden: die rot markierten Punkte zeigen die Standorte der ehemaligen
Steinbrüche in der Gemarkung Heuchlingen. Die Lage der Brüche und die
folgenden Standortbeschreib-ungen
basieren auf Aussagen von Zeitzeugen. Qu.: H. Funk, I. Fischer, A. Hägele, A. Knödler, G. Barth, Hans Röhrle,
Bruno Schierle u.a. Die blau markierten Punkte zeigen einen Ausschnitt der
Sandstein- Lagen im Leintal. Die Sandsteine liegen im „Keuper“, im Gegensatz
zu den Steinbruch- Felsen, die im „Jura“ liegen oder besser, im „Jura“
entstanden sind. Gesteinsschichten und Gesteinsarten im
Leintal** - eine grobe Aufgliederung: Stubensandstein
und Knollenmergel im Keuper.
Bis unter das Niveau der Lein- ca. 382 m ü. M, bis vielleicht 30 m darüber,
zeigen sich in unserem Leintal oft 5 -10
Meter mächtige Felsriegel aus Stubensandstein. Angemerkt:
diese Stubensandsteinschicht kann eine Mächtigkeit bis zu 100 m erreichen
und 50 m oder mehr unter das
Fluss- Niveau reichen. Aus diesem Felsgestein nun, wurden schon seit Urzeiten, Bausteine für
Kirchen, Burgen und Wohngebäude gewonnen. So auch unsere, im Jahr 1492
erbaute Pfarrkirche, die 1786 neu aufgerichtete
Zehntscheuer und dann vor allem das im 13. Jh. erbaute Schloss.
Hier kann jetzt sogar angenommen werden, dass unser Schloss nicht nur
auf einer solchen Sandsteinformation erbaut ist, sondern, dass zugleich
das umgebende Schloss- Areal, hier vor allem der Schlossgraben, gleichzeitig
auch als Steinbruch - einer der ältesten in Heuchlingen, gedient
hat. Viele Kirchen, Burgen und
Schlösser wurden in jenen Zeiten auf diese Art errichtet: bauen auf
Felsgrund mit dem den Bau unmittelbar umgebenden Felsmaterial. Vieleicht
ist auch unsere Pfarrkirche auf diese Art erbaut worden. Knollenmergel: Über dieser
erwähnten Stubensandstein- Schicht liegt nun eine ca. 12 Meter dicke
Knollenmergelschicht - in unserer Gegend berühmt, berüchtigt.
Über dem Knollenmergel
setzen nun die sogenannten Psilonoten
- Schichten alpha 1 ein. Ein Stein- Erdgemisch, z. Tl. auch
mit kleinen geröllhaltigen Felsbänken. Die Psilonotenschichten
können bis zu 5 m mächtig sein. Er ist nach dem in den Schichten
vorkommenden Ammoniten Psiloceras psilonotum benannt – a.wikipedia. Schloheimia-he2
(alpha2)-Schichten. Als 2. Schicht folgen
nun die „Schloheimia-he2 (alpha2)-
Schichten. Dessen Hauptbestandteile sind die Angulaten- Sandsteine.
Sie bilden bis zu 7 Meter mächtige Felsbänke. Dieser Stein ist es nun,
der wahrscheinlich in den Steinbrüchen um Heuchlingen häufig gebrochen wurde. Er war der klassische Baustein
für den Haus- und Mauerbau, für Portale, Gesimse oder Bildstöcke u.a.
An der oberen Kirchhofmauer, aber auch noch anderen
Stellen ist er schön zu erkennen - Wagenhaus „Lauchbauer“ und altes Haus „Kübler“. Gryphaeen-si1
(alpha3)- Schichten. Über den vorgenannten
Angulaten- Sandsteinschichten liegt nun als 3. Schicht, eine bis zu 2 Meter mächtige, bläulich aussehende Felsbank, erst mit einzeln
eingelagerter Versteinerung, dann gefolgt von Gesteins Felsriegel, durchsetzt mit unzähligen fossilen- Einschlüssen. Dieser
bläulich aussehende Fels ist ein hartes,
sprödes Gestein und ebenso schon lange Lieferant für Bausteine,
besonders aber - da sehr witterungsbeständig,
für den Wege- und Straßenbau: Schotter und Splitt, Rohstoff für
Zement u.a. Als oberste
Schicht ist jetzt vielleicht noch die Beta-Schicht
zu nennen. Es sind bis zu 15 Meter mächtige Kalkbankzonen aus einem
Gemisch aus Tone, Tonmergel, schieferartige Einlagerungen u.a. - **unterstützende Quellen: H. Blessing,
R. Übelhör, W. Trinkle, u.a. Bemerkenswertes: Diesen oben
beschriebenen Schichtenaufbau konnte man - in Teilen, im Haupt- Entwässerungsgraben
des Baugebiets Häfner, Anfang Mai 2013 sehr schön erkennen.
Steinbrüche
Die Steinbrucharbeit Eine kräftezehren
und gefährliche Schwerstarbeit,
dazu noch schlecht bezahlt. Zuerst musste eine mehr oder weniger dicke
Erdschicht über den Felsbänken abgetragen und das Felsgestein freigelegt
werden. Der Abraum wurde gleich in der Nähe abgelagert oder hangabwärts
aufgeschüttet. Noch heute sind die mit Trichtern und Wällen zerfurchten
Steinbruchareale als solche zu erkennen Mit Pickel,
Spitzhacken, Schlegel, schweren
Brechstangen, Keilen, wurden die freigelegten Felsriegel dort gespalten
und ausgebrochen. Später übernahmen dann auch Bohrmeißel und Sprengpulver
einen Teil der mühsamen Knochenarbeit. Größere
Platten, Steinquader oder gängige Passstücke wurden gleich vor Ort für die verschiedenen Verwendungszwecke sortiert
und bereitgelegt, ein Teil auch auf die geforderten Größen geschlagen.
Bruchgestein wurde auf Fuhrwerke verladen und an Sammelplätze transportiert.
Ein Teil davon eignete sich dann auch direkt gleich als Schotter für
den Wegebau. Der andere Teil wurde mit Schlegeln
zunächst zerkleinert und sodann von einer größeren Anzahl von Steinklopfern
mit ihren speziellen Steinhämmern (bei uns hatten sie häufig einem elastischen
Stiel aus Schwarzdorn) zu Stücken in Schottergröße zerkleinert. Dem
Verfasser ist noch gut das Bild vor Augen, wie - es war in den späten
1940er Jahren, ein langer, etwa 1 mtr. hoher Riegel von Bruchsteinen
entlang auf der Küfergasse abgelagert war. Auf kleinen, meist einfüßigen
Schemeln oder auf groben „Rupfensäcken, saßen und knieten die „Steinklopfer“
und zerkleinerten in tagelanger Arbeit die Steinbrocken zu Schotter.
Eine wichtige Arbeit damals. Waren doch in jener Zeit die großen - gewerbemäßig
betriebenen Steinbrüche der Umgebung noch nicht in Betrieb. Außerdem
wäre auch die erforderliche Transportkapazität nicht zur Verfügung
gestanden. Die Wege und Fuhren in der Gemeinde mussten aber instandgehalten
und erneuert oder neue angelegt werden. Zugleich bot es auch Arbeit
für einen nicht geringen Teil von beschäftigungslosen Männern jener
Zeit in der Gemeinde. Steinbrüche
in der Gemeinde Heuchlingen. Steine wurden in Heuchlingen in großen
Mengen gebrochen, in Handarbeit
zerkleinert oder auf Maß gehauen.
Verwendet wurde das Material neben dem Haus- und Mauerbau, hauptsächlich
für den Straßen- und Wegebau. Nr. 1: Steinbruch im Hornfeld Nach Aussage
von Georg Barth hatten noch seine Eltern im „Bilzen“ einen Steinbruch. Er lag wohl um die 60 m unterhalb
und 50 westlich der Ruhebank unter dem Fahrweg durch das Hornfeld in
Richtung Horn. Die ungefähren Lage- Koordinaten: N= 48°, 51´, 5,9´´, O= 9°, 56´, 3,1´´, bei einer Höhe von 420 – 422
m. (Nähere Einzelheiten über diesen Stein weiß G. Barth nicht mehr -
er spricht dann aber von einer etwas abweichenden Gesteinsart - etwas
mehr Gruscht. Int. angemerkt: hier könnte es
sich um eine Psilonoten- Schicht
alpha1- siehe oben, gehandelt
haben. Hier darf jetzt
noch angefügt werden, dass in Heuchlingen, außer an den oben aufgezeichneten
Stellen, noch an zahlreichen
anderen Stellen Steine gebrochen wurden. Der Anlass dabei
war oft der, dass beim Pflügen auf hartnäckige
Steinriegel gestoßen wurde. Bei dem Versuch diese zu entfernen stellte
sich manchmal eine Mächtigkeit 1 oder mehreren Metern heraus. Nun, das Ackerland
war rar und wertvoll. Man brach die Steine – meist für den eigenen Gebrauch.
Hierbei muss man noch erwähnen, dass
auf vielen Ackerfeldern, bei
jedem Pflügen, Steine buchstäblich zu wachsen schienen – wie Kartoffeln
- eine Plage. Nun, man ließ die Steine nicht auf den Feldern liegen
(wie heute), man sammelte sie von Hand, legte sie in Reihen auf kleinere
Häufchen, lud sie auf Mistwagen und fuhr sie ab - alle Hände waren da
gefragt, Kinderhände und Frauenhände. Die Steine waren ein willkommener
Rohstoff für alle möglichen Zwecke. Steinbruch Nr. 2 über dem Hornfeld Am westlichen
Ende des Rains über dem Hornfeld lag, ein weiterer privat betriebener
Steinbruch. Er war vermutlich im Besitz von T. Werner i. d. Vorstadt.
Das Feldstück wurde später von J. Röhrle erworben. Hans Röhrle hat das Bruchgelände dann aufgefüllt.
Koordinaten: N= 48°, 51´, 4,5´´ | O= 9°, 55´, 45,3´´ | Steinbruch
Nr. 3 und 4 am Letten-Rain Nr.3: Am westlichen Ausläufer des Letten-Rain
hatte Alois Röhrle einen privaten Steinbruch. Qu. Hans Röhrle. Nr.
4: Am unteren
Rand des Letten- Rain, etwas östlich, oberhalb v. Anwesen „Epple“, liegt
der ehem. Steinbruch „Klopfer“- heute Tiergehege. Von Klopfer
(Lotte H.) wird das Feldstück
heute noch als „Steinbruch“
bezeichnet. Für beide Brüche liegen keine näh. Einzelheiten vor. Die
ungefähren Koordinaten hier: N=48°, 51´, 22,9´´ | O=9°, 56´, 25,8´´
| H= ~454m.
Auf dem hofeigenen Steinbruch, unweit
v. Hof gelegen, wurde viele Jahrzehnte lang Steine gebrochen. Er lag
20- 30 m über- und ca. 100m östl. vom Riedhofquellbach. Nach Isidor
Fischer, (verst.) handelte es sich bei dem Steinmaterial eher um einen
gelben Stein- siehe Angulaten- Sandstein. Die ungef. Lage- Koordinaten:
N= 48°, 51´, 37, 4´´ | O= 9°, 56´, 14,2´´ - H. ca. 452 m.
. Legenden
. . Nr. 6 - Steinbruch
beim Kiarth und der "schöne blaue Stein" - Lage- Koordinaten
ca.: N= 48°, 51´, 40, 4´´ | O= 9°, 56´, 37,4´´. Höhe ca.
440 m (Steinbruchgrund) Ein privater Steinbruch wurde auch auf
dem nahe gelegenen Kiarth- Hof betrieben. Er lag ca. 150m rechts oberhalb des Hofanwesens, unter
dem Weilerrain. Seine Ausdehnung betrug etwa 150 m Länge u. 50 m Breite.
Hier brach der Alexander Lutz seine so
"schönen blauen Steine". Wo lagen die schönsten Steine?
Die in den Steinbrüchen tätigen
Steinbrecher, vor allem auch ihre Besitzer, prahlten oder hänselten
sich untereinander, welcher Steinbruch die schönsten Steine hervorbrächte.
Auf dem Riedhof war es z. B. eher ein "gelber
Stein".
Offene Felsformation in Verlängerung zum Kiarth- Steinbruch N= 48° 51´ 40,8´´ | 9° 56´ 40,5´´ Wissenswertes zum blauen Stein. Der "Blaue
Stein" wurde gerne für Stütz - und Gartenmauern verwendet,
er ist im Waldstetter- Heimatmuseum zu sehen. Dieser wurde bei Ausgrabungen in Alfdorf gefunden. Er gehört zum
Schwarzen- Jura- alpha3 und hat eine Mächtigkeit von mehreren Metern.
Der bei Lutz beschriebene Stein kommt eventuell aus der gleichen Gesteinsformation.
Ist auch er – "der schöne blaue
Stein"? Bruchstein im Hauptkanal des Baugebiet Häfner . Die Gesteinsschicht liegt in ca. 440 - 445 m Höhe, etwa gleichauf mit
dem Kiart-Steinbruch
Die Steinbrüche Nr. 7 und 8 Links über
dem alten Fahrweg nach Holzleuten, noch vor der Markungsgrenze zu Holzleuten, heute im Wäldchen versteckt, lag
der gemeindeeigene Steinbruch von Heuchlingen. Auf alten Flurkarten
ist er als solcher noch mit diesem Namen eingetragen.
Der Steinbruch wurde später dann aufgelassen - der notwendig werdende.
Abraum wurde zu groß. Seine ungefähre Lage: N= 48°,51´, 8,2´´ | O= 9°,
57´´, 28,3´´ Höhe ca. 445m. Gleich in Verlängerung zu diesem Bruch, nach der Markungsgrenze, plante die Gemeinde
Hlzl. einen Steinbruch vor. 1822 erwarb sie für diesen Zweck das Haus
und den Garten von Haus 4- heute Dolderer- um in dessen Garten einen
ergiebigen Steinbruch für den Straßenbau zu erhalten. Holzleuten hatte einen
weiteren, eigenen „Gemeinde-Steinbruch“
am Lindenrain.
Er Lag
über dem linken Bachufer, beginnend etwa zwischen Hirts Stall und dem
jetzigen neuen Wohnhaus. Er reichte vor bis auf Höhe von Strohbauers
heutigem Wirtschaftsgebäude.
Offen liegende Felsformation am Lindenbrunnen-Rain,
unweit vom ehemaligen Steinbruch „Schierle“. Diese Formation
setzt sich ca. 800 m in östliche Richtung fort und mündet im ehemaligen
Holzleuter- Stein-bruch.
Über dem Gewand
„Wolfsgrub“, am oberen Rand des
Lindenbrunnen-
Rains, zwischen Holzleuten und dem Rand der Neubausiedlung im Gehren,
lag ehemals ein großer Steinbruch. Die Größenmaße sind heute noch unschwer zu erkennen. Der Bruch gehörte zum Anwesen „Schierle“
an der Schechinger Straße. Seine Koordinaten: N: 48°, 50´, 59,4´´
| O: 9°, 57´, 11,5´´ | H= ca. 437 – 440m Wissenswertes: Die
letzten Steine hat hier Bruno Schierle 1953 gebrochen. Das Volumen schätzt
er auf 15 qm. Benötigt hatte er die Steine für seinen Hausbau im Jahr
1954. Sie dienten zur Aus-schotterung der Baugrube und
der Hofeinfahrt, dann als Sickersteine an den Außenmauern. Das Plattenmaterial
wurde zum Bau von Gartenmauern verwendet. Bruno Sch. erinnert sich dabei
noch an einen fleißigen Helfer, an Oswald Losert. Oswald war damals Hütebub auf dem Schierle-Bauernhof.
Oswald musste bei der Steinbrechtätigkeit immer den Bohrmeißel gerade
halten und ihn dabei, nach jeden Schlag mit dem schweren Hammer, etwas
um die eigene Achse drehen. Zwischendurch wurde das ca. 2 cm dicke Bohrloch
mit einem langen, schmalen Blechlöffel
immer wieder freigeräumt. Wenn die erforderliche Bohrlochtiefe
von 20 oder 30 cm erreicht war, wurde als Erstes die Zündschnur in das
Bohrloch eingeführt und danach 15 bis 20 cm tief mit Schwarzpulver
gefüllt. Über das Schwarzpulver kam jetzt eine Schicht Papierschnitzel,
darüber eine Schicht Gesteinsmehl. Dieses Gemenge wurde nun mit einem
Holzstock vorsichtig verdichtet. Nun konnte die ca. 30 cm aus dem Bohrloch
ragende Zündschnur angezündet werden. Bruno und Oswald brachten sich
nun im raschen Lauf in ca. 100 m Entfernung in Sicherheit. Bei der folgenden
Explosion gab es dann immer einen regelrechten Steinregen. Die umher
geflogenen Steine mussten danach wieder eingesammelt werden.
Diese beschriebene Sprengarbeit machte Bruno
natürlich selbst –und ohne Spreng-Genehmigung. Den Bohrmeißel und den Räumlöffel hatte er vom
Kiarth-Bauern Lutz ausgeliehen. Nach
Aussage v. Bruno Sch. wurden im Kiart-Steinbruch die Steine schon sehr
früh, bis zur Schließung, fast ausschließlich mittels Sprengung gewonnen.
Ähnliches gilt auch für die Steinbrüche Rieg und Funk auf dem Mäderhof. Links über
dem Rain, an der Neuen Mögglinger Straße, ca. 200 m vor der Ebene,
liegt ebenfalls ein aufgelassener Steinbruch. Das Gewannstück wird heute
noch als „Steinbruch“ bezeichnet.
. . Steinbruch
Nr. 11 auf dem Galgenberg. Er ist heute noch als solcher zu
erkennen - der heutige Reitplatz zwischen alter Reithalle und SAV-Hütte.
Der größere Teil gehörte der Gemeinde. Ein schmaler Streifen dem Wilhelm Arnold. Die Platzgröße und Form zeugt
von einem Abbau in größerem Maßstab.
Steinbrüche
auf dem Mäderhof
Am Rain, schräg
über dem Kindermann-Anwesen unterhalb der Rainoberkante entlang in süd-
westlicher Richtung zog sich der Riek Steinbruch. Die Bruch-
und Abraumflächen sind heute noch zu erkennen. Koordinaten in etwa:
N 48°, 50´, 34,3´´ | O= 9°, 55´, 42´´ H= ~435m. Weiter den Rain entlang in süd- westlicher
Richtung über dem Bach gelegen und in der Nähe des großen Betonmastes,
grub Funk seine Steine. Die Koordinaten hier: N = 48°, 50´, 31´´ | O= 9°, 55´, 40´´ H= ~437m. Steinbruch
Lutz, Nr. 14 Gleich in Verlängerung,
südlich zum Steinbruch Funk – rechts vom Fahrweg nach Schönhardt, hatte das Anwesen Lutz / Pfisterer ebenfalls
einen hauseigenen Steinbruch. Seine Koordinaten betragen etwa N = 48°,
50´, 25´´ und O = 9°, 55´, 43,5´´, H. ca. 449m? (neu arrondiert) Bemerkenswertes:
Lutz war angeblich ein Hüne von einem Mann. Er brach die Steine selbst
und fuhr sie mit dem Kuhfuhrwerk
u.a. auch zur genannten Leinzeller Straße. ........................... Stubensandsteinbänke finden sich zu beiden Talseiten der
Lein und auch an den Steilhängen des Küferbachs und Sichenbachs. Die
Felsen ragen z. Tl. unter das Wasserniveau der Lein- ca. 382 m ü. M., bis in eine Höhe von 415 ü. M. im „Reutewald-
Hag“ oder „Vogelsang“ Die Lagen - wir beginnen links der Lein im Gewand
„Höll“ und folgen den blauen Punkten im Übersichtsplan
Grabsand
Sandsteinfels in
dem „Höll“- Wäldchen, rechts an der Waldfuhre gelegen. Das Gesteinsmaterial
ist grobkörnig und lässt sich mit einem Stock leicht ablösen.
.
Bild: Sandsteinfels in der „Höll“
Sandsteinfels im „Becka-
Wäldle“- nahe Sportklingenmaier.
Sandsteinfelsen am rechten Ufer des Siechenbachs - hier:
bei der „Grotte“ Sandsteinfels- Grabsand - über den Wiesen im mittleren Teil des
„Vogelsang“ Das
Gesteinsmaterial ist grobkörnig und lässt sich mit einem Stock leicht
ablösen. Lage:
N= 48°, 51´, 35,4´´ | O= 9°, 57´, 17´´ | H= ~ 402 m Sandsteinfelsgruppe- Grabsande im unteren, rechten Vogelsang- Waldteil. Die
Gruppe besteht aus 4 oder 5 Blöcken, waagrecht gelegen, auf ~ 40 m verteilt. Der Fels sandet stark und
lässt sich leicht herauslösen. Lage: N= 48°, 51´, 37,4´´ | O= 9°, 57´,
30,1´´ | H= ~ 395 m Sandsteinfelsen am rechten Ufer der Lein im Schafwald,
Gemarkung Laubach. Eine Sandsteinbank,
die bis unter das Lein- Niveau
reicht. Lage: N= 48°, 51´, 33,9´´ | O= 9°, 57´, 45,2´´
| H= ~ 382 m (Leinniveau) Sandsteinbank
am linken
Bachufer im Schafwald, ca. 120 m oberhalb der Bachmündung in die Lein.
Lage: N= 48°, 51´, 30,2´´ | O= 9°, 57´, 44,4´´ | H= ~ 391 - 394 m Sandsteinriegel am rechten Leinufer, ca. 100 m oberhalb
der Behelfsbrücke, unter dem Wäldchen. Die 3 – 6 m mächtige Felsformationen
erstreckt sich über 60 bis 80 m entlang des Steilufers und reicht bis
unter die Wasseroberfläche. Lage: N=
48°, 51´, 28,3´´ | O= 9°, 57´, 24,7´´ | H= ~ 382 m (Wasserniveau)
Bild: Sandsteinriegel am rechten Leinufer ca.
120 m rechts der Behelfsbrücke über
die Lein.
. . . . Bild: Sandsteinbank am/
im Küferbach Die
Felsbank reicht unter das Wasserniveau. Lage: N= 48°, 51´, 4,5´´ | O= 9°, 56´, 52,8´´
Ergänzungen Sandstein-
Felsbank unterm Schloss. Linkerhand vom Keller gegenüber dem Haus Krämer, zeigt sich ein Sandsteinriegel.
Er liegt in Höhe der Kellerdecke, und mündet etwa auf dem unteren Niveau des Schlossgrabens
in einer Höhe v. ca. 396- 398
m. Der Kellereingang liegt auf einer Höhe von ~ 394 m, der Schlosshof bei ca. 401 - 403 m. Int. Anmerkg: das bekräftigt die Annahme,
dass das Schloss auf Stubensandstein-Felsen gründet und dass im Umfeld
(Schlossgraben) das erforderliche Baumaterial (Sandsteinquader) gewonnen
wurde. Sandsteinbank beim ehem. Kellerhaus a. d. Brackwanger
Straße. Rechts der Keller und über Kellerhöhe, zeigt sich ein weiterer
Felsriegel aus Stubensandstein. N= 48°, 50´, 59´´, O= 9°, 56´, 33,7´´,
H= ~ 394 m. Die Felsformation reichte früher bis zum Bachbett des Tiefenbachs
und ragte hoch bis zur Oberkante des ehemaligen „Oberstberg“. Hier sind
dann auch die erwähnten Keller eingegraben. Der ehemals danebenliegende
Felsbrunnen ist eingegangen.
................................ .................................... ............................. Erhaltene alte Mauern und Mauerreste in Heuchlingen
An der oberen Kirchhofmauer, aber auch neues Wagenhaus ganz von Stein. Daneben diente das Wagenhaus auch als Heulager. Später wurden das Wagenhaus mit den neu auf den Markt gekommenen Hohlblocksteinen überbaut. Ein Teil der Grundmauer aus "Angulatensandstein"- direkt auf den Grund gebaut, ist noch gut auszumachen. s.Bild oben. Die Problematik solcher Naturmauern im Zeitenlauf ist leicht zu erkennen: Schichtenabspaltungen, Hebungen, Senkungen, Eis und Frost, Regen, Hitze u.a.
Haus Barth - "Kübler"
am Kirchberg. schnitten. .
zurueck
zu Navigation 5 - ......... |
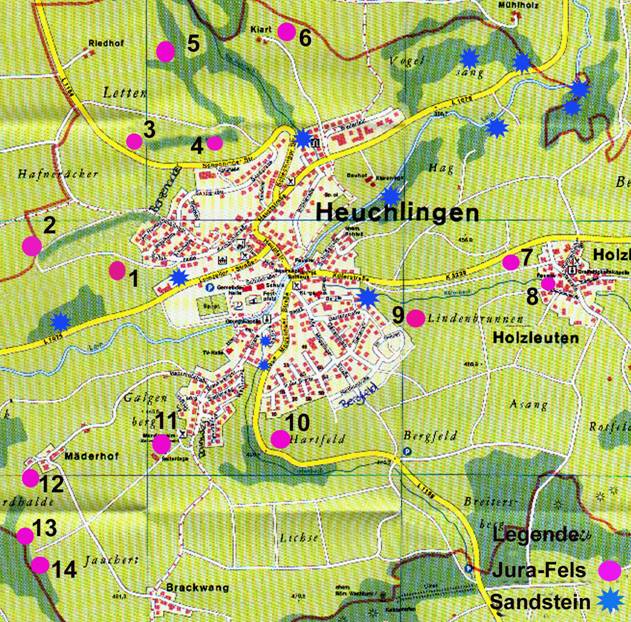
 Auch
wenn die alten Germanen dann, nach dem Abzug der Römer, deren Wegebau-Technik
und auch die Technik der Zementherstellung buchstäblich für lange Zeit
vergessen hatten, war dann, mindestens seit Beginn der Besiedlung unseres
Raumes,
Auch
wenn die alten Germanen dann, nach dem Abzug der Römer, deren Wegebau-Technik
und auch die Technik der Zementherstellung buchstäblich für lange Zeit
vergessen hatten, war dann, mindestens seit Beginn der Besiedlung unseres
Raumes,