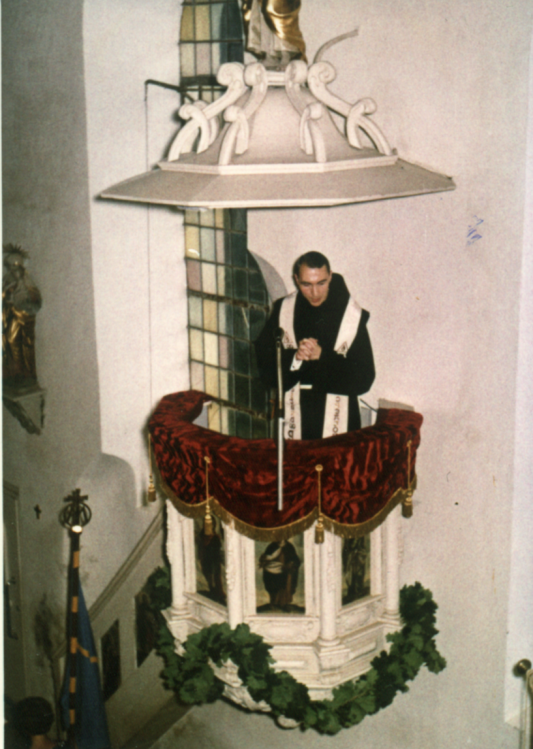|
Zeitzeugenwissen
und verborgene Erinnerungen zum Heuchlinger Fest.
Welche Erinnerungen
an das Heuchlinger Fest aus der - eher vergangenen Zeit- lassen sich
noch abrufen? Was wissen Zeitzeugen noch?
Gesprochen hierüber wurde mit Bruno Schierle, Jg. 1926, Otto Bauer,
Jg. 1926, Anton Knödler, Jg. 1927, Mathilde Klotzbücher v. Leinweiler,
Jg. 1926. Rudolf, Otto- und Maria Schmied u. noch vielen anderen nach
ihren Erinnerungen und Erinnerungen/ Überlieferungen ihrer Väter und
Großväter.
Unsere Abfragen:
<
Kirchliche /religiöse- u. der weltliche Abläufe des Festes in
den Wochen und Tagen vor und am Fest selber?
< Krämerstände am Fest: welche Kaufleute waren beteiligt?
Wer stellte das Verkaufs-personal? Was wurde verkauft? Wie lange dauerte
diese Tradition an? usw.
< Besonderheiten: wie Böllerschießen zum Tagesbeginn am
Festtag, Prozession mit Musik u.a.
…
Der religiöse Ablauf - übergehend
in den weltlichen Bereich.
Alle
Befragten erinnern sich- weit zurück in ihre Kindheit- an ein
immer stark religiös geprägtes Fest - ein starkes Empfinden besonders
aus der Sicht als Schüler und angehender Erwachsener. Schon vor
der beginnenden Festvorwoche steigerte sich die innere Anspannung.
Die Gespräche und auch der Alltag drehten sich verstärkt um das Fest.
Die Festwoche war dann ausgefüllt mit Beichtgängen- sie schafften
nicht selten Unwohlsein und auch eine gewisse Furcht- Besuche der
Abendandachten oder der Abendgottesdienste mit den Predigten. Gesteigert
wurden die Empfindungen noch, wenn diese Fest-Vorwoche als Missionwoche
abgehalten wurde. Ordensmissionare aus Ellwangen, Neresheim u.a. versuchten
in langen Glaubensgesprächen und mächtigen Predigten und Worten den
Glauben der Schülern und der Jugend, der Frauen und Männer zu stärken
und zu festigen. Dies alles hinterließ dann immer einen tiefen und
nachhaltigen Eindruck voller innerer Spannung. Diese Spannung setzte
sich fort, hinein in die einzelnen Hausanwesen.
Eine
eher weltliche Seite.
Schon Tage vor dem Fest war der weibliche Teil der Dorfbevölkerung
- Mütter, Großmütter und Mädchen, mit putzen und wienern der Stuben,
Küchen, Stiegen und Hausflure beschäftigt. Meist wurde doch Verwandtschaftsbesuch
aus der Stadt oder anderen entfernten Orten erwartet. Da sollte es
dann besonders ordentlich aussehen. Die Festtagskleider für die Erwachsenen
und Kinder mussten hergerichtet werden. Das gute Geschirr für den
Mittagstisch wurde aus den Stubenbuffes hervorgeholt und das Festtagsessen
vorbereitet.
Auch die Männerwelt hatte ihren Teil zu tun. Die Arbeitsgerätschaften
und das Wagengeschirr wurde in die Wagenhäuser
und Schuppen geräumt. Die Hofeinfahrten und Wege mussten sauber geräumt
und gekehrt werden - die Dorfstraßen und Wege in jener Zeit - den
1930er, 40er oder 1950er Jahren, waren noch Erdstraßen und nicht geteert.
Diese Arbeiten oblag dabei meist den Buben und Heranwachsenden. Wie schon
an Fronleichnam, wurde auch jetzt für die Gestaltung des Prozessionsweges
feines Gras eingeholt und auf den vorgesehenen Weg ausgestreut. Ebenso
mussten die "Maien" geschlagen und entlang des Weges eingesteckt
werden. Das Schmücken der Häuserfassaden war dann wieder mehr die
Arbeit der Frauen und Mädchen.
Das Fest konnte also kommen, alles war bereit.
Am Festsonntag war es dann ein erheb-endes Gefühl, beim Kirchgang
all die vielen Besucher zu sehen die den Kirchberg hoch und der Kirche
zustrebten. Auch ein gewisser Stolz erfasste dabei die einheimischen
Kinder und vielleicht auch den einen oder anderen Erwachsenen.
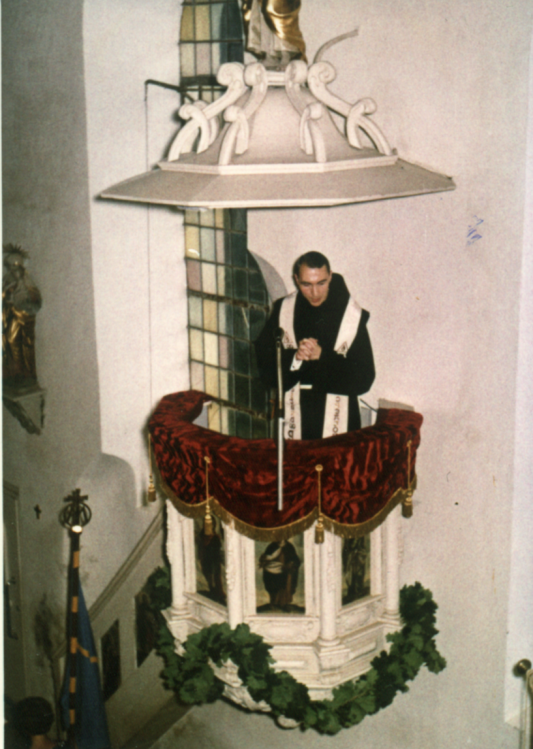 Das
feierliche, *levitierte Hochamt am Festtag- oft zelebriert von
einem Ordenspater, begleitet durch den Ortspfarrer und weiteren Geistlichen,
die Festpredigt- meist mit großer
Stimmgewalt gehalten, und die darauf folgende feierlichen Prozession
durch das Dorf, bildete dann den krönenden Höhepunkt des Heuchlinger
Festes.
Das
feierliche, *levitierte Hochamt am Festtag- oft zelebriert von
einem Ordenspater, begleitet durch den Ortspfarrer und weiteren Geistlichen,
die Festpredigt- meist mit großer
Stimmgewalt gehalten, und die darauf folgende feierlichen Prozession
durch das Dorf, bildete dann den krönenden Höhepunkt des Heuchlinger
Festes.
Ein schöner Brauch war dann auch - und
ist es noch immer, nach dem Hochamt und der anschließenden Prozession,
alle Geistlichen, Mesner und den Kirchenstiftungsrat- heute KGR, zum
Mittagsmahl in eine Gaststätte zu laden. Gastgeber war, und ist es
noch heute, die Kirchengemeinde.
Noch
eine Erinnerung sollte vermerkt sein: Extra zum Hchl.-Fest wurden
auf den Feldern die ersten Kartoffelstöcke ausgezogen und der Festtags-Kartoffel-salat
damit angemacht. Auf dem Heimweg - nach dem feierlichen Amt, wehte
den zahlreichen Kirchenbesuchern auf den Gassen dann immer ein köstliche
Geruch von Kartoffelsalt und Schweinebraten aus den Fenstern der Häuser
durch die Nase. In manchen Augenblicken meint man den besonderen Geruch
noch zu spüren.
…………………
Verkaufsstände bei der Kirchenlinde.
Abgesehen
von dem alles beherrschenden zentralen Fest, erinnern sich die Befragten
an nichts so sehr, wie an die Verkaufsstände bei der "Kirchenlinde"
am Aufgang zur Kirche. Bei Allen Befragten taten sich lebhafte
Erinnerungen auf, jeder wusste eine Besonderheit zu berichten, andere
bestätigten sie oder widersprachen. Den Kindern und Heranwachsenden
haben diese Verkaufsstände ganz offensichtlich ein nachhaltiges Erlebnis
hinterlassen. Eigentlich kein Wunder, der Dorfalltag war eintönig,
und arbeitsreich, die Kriegs-und Nachkriegsjahre entbehrungsreich.
Die Kindergeneration heute würde über solche Stände wohl nur müde
lächeln. Damals aber, nun…...
Gasthäuser und Verkaufsgeschäfte um die Kirche finden sich
an allen Wallfahrtsorten- so einer war Heuchlingen - zumindest früher,
ja auch und spielten eine nicht unbedeutende Rolle.
Eine Gaststätte bei der Kirche hat Heuchlingen zwar nicht, aber doch
schon sehr früh einen Krämerladen. Der Wanderkrämer Nicolai Ohnewald
ließ sich um 1708 in Heuchlingen nieder und richtete auf dem Kirchberg
einen Krämerladen ein. Johann Mezger heiratete 1855 dort die Tochter
des Krämers Josef Ohnewald.
…..
..... .....
Kleine Kaufhausgeschichte v. Hchl. – eingefügt
Um
1883/84 erwerben Johann Mezger und dessen Sohn Alphons im Dorfkern
ein Grundstück und errichteten darauf ein großes und, für die damalige
Zeit, modernes Kaufhaus.
1910 oo Maria Wöller den Kaufmann Josef Stütz in der Postagentur
Haus 15 am Schlossberg. Vermutlich wurde zu dieser Zeit dann auch
das Kaufhaus am Schlossberg eingerichtet.
Das Kaufhaus Mezger bot sozusagen ein Vollsortiment, wie Kleider,
Stoffe, Aussteuer - und Haus-haltswaren, sowie Lebensmittel. Auch
Eisenwaren und landwirtschaftliche Geräte und Dienstleistungen waren
im Angebot. Während das Kaufhaus Stütz in geringerem Umfang ebenfalls
Stoffe, Vorhänge, später auch Kleider und Pullover, Aussteuerwaren,
Geschirr und ebenfalls Lebensmittel im Angebot führte.
Schon
früher, in der 2. Hälfte des 19. Jh. -1862 erstmals, richtete
Katharina Ottenbacher, + 1916, im Haus Nr. 104 - ist das heutige Haus
"Ilgauds" - einen Krämerladen ein.
Einige
Zeit später, etablierte sich auch im Haus 104 - bis in die 1930er
Jahre hinein, ein Krämerladen der Kreszentia Ohnewald, *1856, +1938.
Haus 104 ist das Vorgängerhaus der heutigen Gemeindewohnung am Bergle.
Ende
der 1920er Jahre erbaut Eberhard Beierle am Aufgang
zum Kirchberg ein neues Kaufhaus. Er beginnt hier zunächst mit einem
Eisenhandel. Diesen dehnte er später zu einem "Gemisch - u. Kolonialwaren"-
Geschäft" aus. Im Angebot: Süßigkeiten und Lebensmittel, Gerätschaften
für die Landwirtschaft und Handwerker, wie Ketten, Seile, Drähte, Nägel,
Fette, Öle usw.
Noch später, in den 1930 er Jahren, eröffnete X. Häberle eine
kleinen "Kolonialwaren -Laden" am Eingang zur Vorstadt.
Diese letztgenannten Krämer stellten aber zu keiner Zeit einen Stand
zum Heuchlinger- Fest.
...
Die Verkaufsstände bei der Kirchenlinde
Vorab:
es ist keinerlei Wissen mehr vorhanden, wann erstmals ein solcher
Verkaufsstand zum Heuchlinger - Fest aufgestellt wurde. Aber, auch
die älteren Zeitzeugen, die 1926 und danach Geborenen, erinnern sich
bis in ihre Kindheit zurück an die beiden Verkaufsstände vom Krämer
Mezger und dem vom Kaufladen Stütz. Beide Stände fanden ihren Platz
bei der Kirchenlinde am Treppenaufgang zur Kirche, genauer an der
nördlichen Giebelseite vom Haus des Bauern Ilg - dem Anwesen der "Kolba-Dones".
Der Stand Mezger war linkerhand, der Stand Stütz rechts daneben aufgestellt
- Lotte H. sieht den Stütz-Stand aber auch gegenüber der Giebelseite
bei der Kirchenlinde stehen. Die Verkaufsstände glichen in ihrem Aufbau
der heute noch vielfach auf den Märkten bekannten einfachen Bauweise.
Einige
ältere Mitbürger berichten auch noch von
einem kleinen Verkaufstand links der Kirchen-linde - später stand
hier ein Ruhebänkle, bevor die Linde aus Sicherheitsgründen dann umgesägt
werden musste. Dieser Verkaufsstand wurde von der *Beede - der Bihlmaiers-Babet,
betrieben. Neben verschiedenen Obstsorten wie Frühkirschen, Beeren
u.a., bot sie noch allerlei Devotionalien u. Tand an, so z.B. kleine,
etwa 10 cm hohe Monstranzen und Kelche u.a. aus Zinn / Blei.
*Beede, -von Bötin/Bote - machte auch Boten- und Verkünddienste in
d. näheren u. weiteren Umgebung.
Das Verkaufspersonal. Der Verkaufsstand
Mezger wurde nach übereinstimmender Aussage immer durch fremdes Personal
bedient. Am Anfang war es die Christine Ilg vom Nachbarhaus. Später
dann auch begleitet von ihrer Schwägerin B. Ilg. (Schuhmachers) Den
Stütz-Verkaufsstand bediente - zumindest in den früheren Zeiten, Frau
Maria Stütz persönlich, so die Aussage einiger älteren Zeitzeugen.
Dann, zumindest in den Nachkriegsjahren, standen
Albert Schuster mit seiner Frau - sie wohnten im Haus 41 auf dem Gänsbühl,
viele Jahre hinter dem Verkaufstisch und bedienten die Kundschaft.
Zuletzt, der Stand Mezger war schon aufgegeben, bediente dann auch
Kaufhausnachfolgerin Frau Bopp, geb. Stütz, persönlich die Standbesucher.
Tand
und Nützliches, Spielzeug, Süßwaren und Anderes. Sowohl
der Stand "Mezger" wie auch "Stütz" hatten auf
ihren Verkaufstischen und Regalen überwiegend Spielwaren und Süßigkeiten
für die Kinder und Heranwachsende im Angebot. Dabei werden aufgezählt:
Waffeln, Mohrenköpfe, Bärendreck, Rahm- Himbeer - und Zitronenbonbons,
"Zickerle" aus großen Glasgläsern für einen 1/2 Pfennig
das Stück, Schokolade, Brausepulver in kleinen Tütchen und mehr. Dazu
Spielzeug: kleine Pfeifchen, Fähnchen, Pusteschlangen. An eher Nützlichem
wurde - besonders am Stand "Mezger", geboten: Skapulier-Medaillen
und Silberkettchen, Heiligenbilchen, Rosenkränze u.a. mehr. An einen
Verkauf von Waren wie: Stoffe oder Anziehsachen (Kleider o.ä.), sind
keine Erinnerungen vorhanden. Auf die Frage, ob in den letzen Kriegsjahren
noch Verkaufsstände aufgestellt waren, kann sich ebenfalls keiner
der Befragten mehr erinnern.
..
Das erste "Speiseeis"
- und Ende der Verkaufsstände.
Ende
der 1940er - oder Anfange der 1950er- Jahre erwarb Xaver Klingenmaier
- der "Veita-Xaver", eine Eismaschine. Diese Maschine reihte
Xaver an die Verkaufsstände an und stellte (2 bis 3 Jahre lang) eigenes
Speiseeis her -"Kugeleis". Wohl die meisten der Heuchlinger
Kinder werden jetzt das erste Speiseeis in ihrem Leben genossen haben.
Später dann wurde am Stand "Mezger" auch das erste "Eis
am Stiel" verkauft. Marianne Schwarz hat es als Lehrmädchen bei
Mezger noch um 1960/61 hinter dem Stand angeboten und verkauft. Qu.
Elisabeth Waidmann.
Kurz nach 1960 / 61 wird dann auch schon der "Mezger-Verkaufsstand
aufgegeben. Der Stand Stütz folgte 1 - oder 2 Jahre später. Eine lange
Tradition ging zu Ende.
……………………
Chorgesang,
Böllerschießen und Marschmusik am Heuchlinger Fest.
Der
feierliche Umzug am Skapulierfest erfolgte in der 1. Hälfte des
19. Jh. mit Pauken und Trompeten, so der Chronist. "Nicht zuletzt
deswegen kamen in jener Zeit zahlreiche Festbesucher aus Nah und Fern
zum " Heuchlinger Fest" - Es war dies die Zeit des Wirken
von "Josef Ohnewald."
Chorgesang: spätestens
nach der Rückkehr von Josef Ohnewald nach Heuchlingen im Jahr 1811
wird sich - parallel zum Aufbau einer Instrumental- Musikgruppe unter
dessen Leitung, allmählich auch der Chorgesang etabliert haben. Die
Chorliteratur in jener Zeit war in der Regel ja für Singstimmen und
Instrumentalbegleitung- Geigen, Pauken, Trompeten u.a.- verfasst.
(eine Orgel in den Kirchen war noch relativ selten anzutreffen)
1830
ist vermerkt: . … es
ist ein Sänger Chor gebildet, der aber izt auf 4 stimmige Gesänge
einübt. Der Schullehrer ist Johann Weber von hier geboren d. 27. Mai
1769. Er ist zugleich Meßner und Organist - Intern: und war ganz sicher
auch der Chorleiter.
Etwas später
, 1834, wird dann allgemein von mehrstimmigen Chorgesang
an Sonn - und Feiertagen und bei Beerdigungen in Heuchlingen berichtet.
Qu.: Auzüge aus dem Kirchenvisita-tionsbericht Abschn. 5 B, Pu. 19
in 1830 (1834)
Orgel. 1819
erfolgte in Hchl. erneut eine gründliche Renovierung der Orgel. Der
Volksgesang ging aber bald wieder stark zurück". Es heißt: "Der
ganze Gesang wurde von wenigen Sängern und Sängerinnen auf der Empore
gehalten" - Es gab also 1819 schon
einen Sängerchor.
A. Deibele zitiert aus dem Tagebuch von J. Ohnewald: "Anfang
Januar 1824 wurde die Kirchenmusik, teils aus Undank einiger Schüler
Ohnewalds, teils mangelnder Unterstützung seitens des Stiftungsrates
aufgelöst". Ohnewald hat später dann den Chorbetrieb wieder aufgegriffen
(und wohl auch nie ganz aufgegeben). Denn in div. Kirchenvisitationsberichten
wird für die Zeit 1830-34 notiert: Orgel spielt der Tonkünstler Josef
Ohnewald. Daneben ebenfalls genannt: Orgel spielt der Mesner und Schulmeister
Johann Weber.
... ... ...
Prozessions-
Marschmusik an Fronleichnam und Heuchlinger-
Fest.
Wie
lange nun in der "Nach- Ohnewaldzeit", also in der 2. Hälfte
des 19. Jh. die Prozessionen mit "Pauken und Trompeten"
feierlich begleitet wurden, ist nicht vermerkt. Möglich oder besser
wahr-scheinlich ist, dass die nicht wenigen Musiker in jener Zeit
im Ort - in den Personenregistern oft als Musikus oder Musikant betitelt,
in mehr oder weniger kleinen Besetzungen diese Tradition weitergeführt
haben. (es bedeutete für sie ja auch einen kleinen Hinzuverdienst)
Festmusik aus Schechingen,
Aus dem 20. Jh. weiß man, dass Musiker der Blaskapelle Schechingen
über viele Jahre der Prozession an Fronleichnam und dem "Heuchlinger
Fest" mit feierlicher Marschmusik voran-gingen. Ja, auch das
sogenannte "Wecken" nach dem Böllerschießen und dem
"Gebetläuten" um 6 Uhr in der Frühe hatten sie übernommen.
Wann nun die Schechinger- Musikanten diesen musikalischen Dienst übernommen
haben, ist nicht mehr bekannt. Aber diese Episode ist den stälteren
Bewohnern noch in Erinnerung: dass die Schechinger Musikanten nach
ihren Auftritten meist noch im "Veith"- Gasthaus "Rose"-
eingekehrt sind. Diese Einkehr dauerte dann nicht selten bis tief
in den Abend, bevor sich dann eine feucht- fröhliche Musikantenschar
auf den Heimweg nach Schechingen machte.
1956 übernahm dann der
neugegründete Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Heuchlingen diesen
traditionsreichen Brauch. Der 1991/92 aus diesem Musikzug entstandene
Musikverein führt ihn bis zum heutigen Tag in gleicher Form fort.
……
Böllerschießen und anderes
Wissenswertes zum Heuchlinger Fest.
Beim
Blättern in den Heiligen-Rechnungen wird sichtbar, wie diese beiden
Hochfeste, Fronleichnam und Heuchlingen Fest, schon vor 200 Jahren
- und früher, nicht nur sehr arbeitsaufwendige, sondern auch kostenträchtige
Tage waren. Dabei lassen sich auch durchaus schon wirtschaftliche
Aspekte erkennen, sowohl für einzelne Dorfbürger als auch für die
Kaufleute im Ort- ganz früher die Krämer und Boten, bis in die Kreisstadt
hinein oder für die Gaststätten im Ort.
Auch lässt der Ablauf und die Außendarstellung
der Feste durchaus auch einen etwas martialischen Zug zu erkennen.
So wurden schon früh, beispielhaft im Jahr 1800, 6 Schützen
für die Mitgestaltung der Feste entlohnt und das notwendige Schießpulver
beschafft. Später wurden sogenannte Böller angeschafft, mit denen
sich dann unter 3 maligen lautem Kanonendonner der Beginn des Festtages
angekündigte.
Angemerkt: Das Böllerschießen findet oft an besonderen Festtagen statt,
zum Beispiel auch an Hochzeiten oder an Neujahr u.a. Es soll böse
Geister vertreiben und den anstehenden Tag oder die Zeit mit guten
Vorzeichen beginnen lassen. Der Brauch des "Taganschießen"
an Fronleichnam und Heuchlinger-Fest hat sich bis in die heutige Zeit
gehalten.
...... .... ....
Auszüge aus Heiligen-Rechnungen. Hier: Rechnungsstellungen für Fronl. u.
Heuchl. Fest.
In
HL- Rechng. v. 1800
bezahlt der Heiligen Pfleger Melchior Ohnewald (es war der Vater des Josef O.) an den
Wirt Joh. Melchior Kieninger für Verzehr und Trank am Fronleichnamstag
für: 4 Himmelträger a`15 kr. = 1 fl., 1 Kreuzträger = 15 kr., 1 Kerzenträger = 15 kr.,
dem H.H. Pfarrer = 1 Maß Wein u. 2 Brot = 58 kr.,
den 10 Musikanten a` 15 kr.
= 2 fl., 30 kr., den Ministranten 20 kr.,
dem Schulmeister d. Verzehr f. d. Maien holen = 20 kr.,
und an 6 Schützen a` 15 kr.
= 1 fl, 30 kr.
in dessen Gasthaus stellt (HL. Rn. Krt.7/8)
1900 - 19009: dem
Kronenwirt Stitz für Getränke an die Festordner 1,6 Mark abgegeben.
|| für das Tragen der Kirchenfahnen an d. Bittgängen, Fronl. u. Hchl.
Fest an 5 Pers. 12,60 Mark abgegeben. || für
das Böllerschießen an Fronl. u. Hchl. Fest an den Josef Arnold je.
3,20 Mark gegeben || dem Kaufhaus Stütz für 4 Schleifen an
die Festordner a. Hchl. Fest 1,25 Mark gegeben. || dem
Kfm. Alphons Mezger für Zündpulver, Böllerspulen und Böllerpulver
12,2 Mark gegeben. || Dem Kfm. Stütz
für Spreng-u. Gewehrpulver 4,8 Mark gegeben. || Dem Schneidermstr.
Joh. Stäb für 1 neue Fahne machen u. Holen der Maien 4,5 Mark gegeben.
|| dem Mesner für das Abstauben der Altäre u. der Heiligen auf Skapulier
und außergewöhnliches Putzen der Bänke und des Boden der Kirche- 4.-
u. 5 Mark gegeben. || für das Herbeischaffen von 12 Tannenbäumen,
4 große im Chor, 6 kleine, jeweils 2 an den Türen und 2 am Ölberg
gegeben …. Mark. - u.s.w.
rechech.
2017 /2018 - a. m.
|