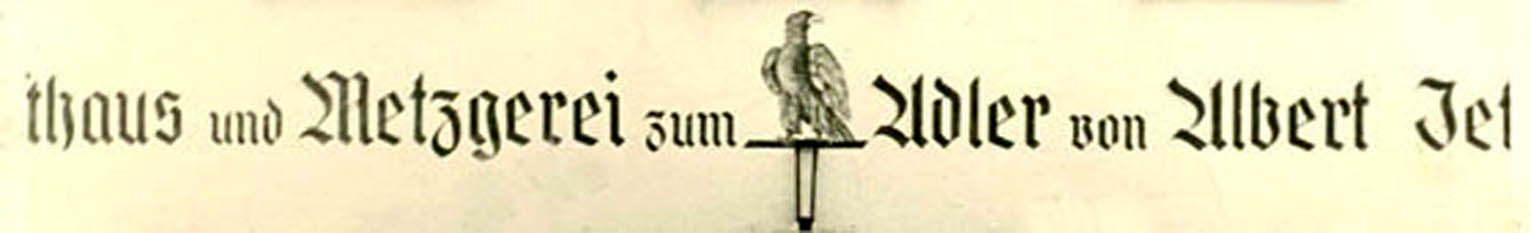|
Der
Adler - Rentamt - Poststaion - Herberge und
Gasthaus Entstehung
der Gasthäuser. Gemeinsame Grundlage für die Entstehung der
Gasthäuser war das Erzeugen von Bier, Wein, Most, Branntwein, um das
Bedürfnis der Bevölkerung nach Unterhaltung, Alkoholgenuss und Vergnügungen
zu befriedigen. Damit verbunden war auch die Ausgabe von Speisen. und die
Beherbergung von Reisenden. So waren die größeren Gasthäuser schon immer auch ein
Treffpunkt bei freudigen und traurige Anlässen. So finden wir das Gasthaus
oft direkt neben, oder in der Nähe einer Kirche, an alten Posthaltestellen
und an Handelswegen, wie es auch für das hier genannte Adler-Gasthaus
zutrifft Wirtshausodnung. Für die Herstellung
und den Verkauf von Bier bedurfte es der vom Grundherrn - Fürst, Graf,
Kloster usw. verliehenen Braugerechtigkeit, da die zum Brauen benötigten
Pflanzen, wie Gerste Weizen, Hopfen und Gewürze auf seinem Grund
wuchsen. Diese "Grutrechte"- Grut = Korn, hatten bis hinein ins 15. Jh. Gültigkeit. Qu.
Auszug aus: Gasthäuser in Waldstetten v. H. Blessing. Im 16. Jh. erließen die deutschen Fürsten dann auch eine
Wirtshausordnung, in welcher die Vorschriften und Verordnungen hinsichtlich
Maße und Gewichte, Vergabe einer
Konzession, Steuern und Abgaben
festgelegt waren. Dafür wurden Steuerschätzer, bzw. Steuereintreiber,
sogenannte Umgelter oder Visierer, eingesetzt. Hierbei wurden auch der Status
des Gasthauses und die damit verbundenen Rechte festgelegt. Die
Taverne oder Taffernwirtschaft hatte das Recht, Getränke und
Speisen auszugeben und Fremde übernachten zu lassen. Sie hatte ebenso das
Recht ein Schild auszuhängen. Daraus entwickelte sich der Begriff
"Schildwirtschaft". Die Rechte und Regeln für zum Betrieb einer Taverne waren
sehr eng gefasst. So heißt es z.B.: gekochte Speisen dürfen
nur zu den Hauptmahlzeiten vorgesetzt werden, ausgenommen sind: " über
Land raisende Priester", damit
sie ungesäumt ihren Sachen nachkommen können . ........................................................... Eine
weitere zweigte von Mögglingen ab nach Heuchlingen und führte weiter über Abtsgmünd
wiederum nach Ellwangen. Auf diesen Kursen befanden sich mit Botenmeistern
besetzte Stationen, u. a. in Schorndorf, Gmünd und Heuchlingen im Leintal.
Die von Stuttgart aus nach diesen Stationen bestimmten Briefe und Sachen
wurden an die dortigen Boten zur Bestellung abgegeben. Namentlich der
Heuchlinger Bote scheint einen großen Bestellbezirk gehabt zu haben, wie
seine Abrechnung mit dem Stuttgarter Botenmeister vom Jahr 1584 ergibt. Die
Stelle soll damals bedeutender gewesen sein als Schw. Gmünd. Der Bote
erhielt, nebst Sommer- u. Winterkleidung, 20 Gulden, 6 Malter Korn u. 12
Scheffel Haber. Ein
interessanter Vermerk hierzu: "Zur Abstellung von Saumseligkeiten ind
der Beförderung der herzogl. Briefschaften, die dem Heuchlinger Boten zur
Last fielen, ihn der Graf v. Rechberg einige Tage (1583) einsperren
ließ" Das
Postwappen war der Reichsadler. So waren die meisten Gasthäuser "zum
Adler" zugleich Poststationen - so auch unser "Adler". Im EG befanden sich die Stallungen,
Lager und die Poststelle und im oberen Stock die Gast - und
Beherbergungsräume. ……………….. Geschichte der Schenkstatt und späteren Gaststätte „Adler“ Qu.: aus dem Heimatbüchlein: „Heuchlingen - alte und neue Zeit“ und Broschüre „750 Jahre Heuchlingen“ Die
Geschichte zur erwähnten
Schenkstatt liegt über einen langen Zeitraum - bis 1569 - im Dunkeln. 1569 -
Balthasar Benner. Im Saalbuch
Heuchlingen von 1569 hat ein Balthasar Benner bei seinem Erbgut und Wirtschaft 3 Viertel Kraut und Grasgarten beim Haus,
11 Tagwerk Wiesen, 9 Jauchert Äcker im
ersten Feld, 8 Jauchert im anderen Feld, 8 ½ Jauchert im 3. Feld (1 Jauchert
~ 1,7 Tagwerk = v. Land zu Land
versch.) endlich zwei Stück Holz, das eine im Mederholz, das andere auf dem
Rain. (Holz, in der Bedeutung von 1 Stück Wald) 1602 besitzt *Hans Benner, von 1591-1633 ellwangischer Schultheiß zu Heuchlingen, mit Fischrechten in der Lein, das Gut und die Wirtschaft. "Er ist dem Probst zu Ellwangen mit aller hohen und niederen Obrigkeit einig und allein zugehörig, soll die zu recht empfangene Schenkstatt in gutem wesentlichen Bau und Ehren halten und jedes Jahr zu Martini seine Abgaben zu der Herrschaft Ellwangen sicheren Händen getreulich entrichten, nämlich 2 Gulden, 46 Kreuzer Herrngült. Aus dem Wasser an der Lein, das zu dieser Herberg und Wirtschaft gehörig, am Badsteg anfängt und bis an das Hag an dem Rank oberhalb des Sandsteins hinabgeht und vom Wirt zum Fischfang jederzeit benützt werden darf, 3 Gulden, 30 Kreuzer, je 8 Viertel, 1 Imi Dinkel und Hafer sauberer Frucht nach Gmünder Meß. Von der Wirtschaft gibt er, solange er sie hat und Wein schenkt, von jedem Eimer (60 – 90 lt. je n. Land versch.) 15 Kreuzer Umgeld, gleichviel, ob der Wein nieder oder hoch geschenkt wird" Hierzu ein Eintrag im Staatsarchiv
Ludwigsburg - Urk. N. 6: Johann Christoph, Koadjutor (Bischof) und Administrator
zu Ellwangen, verleiht am 12.12.1602 dem Schultheiß Hans Benner zu
Heuchlingen die dortige Wirtschaft zu seinem Erblehen. *Hans Benner ist 1533
geboren und vermutlich der Bruder des Balthasar Benner. 1602, zum Zeitpunkt
des Eintrags, ist Hans Benner schon 69 J. alt.
.......... ~1710 bis ~
1755 Balthasar Klein. Auf Wanner folgt von 1707 bis ca. 1755
Johann Balthasar Klein, „Wirt auf der Erbschenke“. Im Pf. Urbarium v. 1827 ist hier
vermerkt: .......... 1755
übernimmt Michael Kieninger das Anwesen von seinem Vorgänger.
.................. ................. Zerschlagung des Adler- Gesamtanwesen
Nach dem Haischbuch von 1813, in
welchem alle Fälligkeiten und Abgaben
festgestellt wurden, betrug der
Güterbestand noch 3 ½ Tagwerk Wiesen und 12 Morgen Äcker. Dabei ist
vermerkt, dass das Lehen zertrümmert
worden sei. ……………………. . |