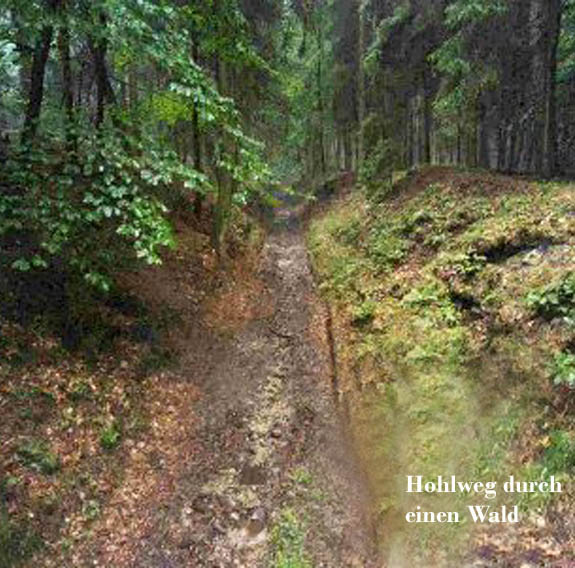|
Fischerweg
- Eisenfuhren und Warentransporte im 17. Jh. von der Fürstprobstei Ellwangen über Heuchlingen in die Reichstadt
Gmünd. Eine
Vorbetrachtung Bis weit in das 18. Jahrhundert
hinein waren selbst die bedeutendsten Heer- und Handelsstraßen unbefestigte
Wege ohne künstlichen Belag. Die alten Wege verliefen daher oft über Bergrücken und Höhenzüge oder entlang
derselben. Sie waren für den Landverkehr günstiger als feuchte Täler,
vor denen die alten Straßen meist auswichen. Das Erdreich dort war
fester, der Untergrund trocknete schneller ab und eine bessere Fernsicht
erleichterte die Orientierung. Die
Wege kreuzten sich oft an markanten
Punkten – markantes Gelände,
an der Kreuzung gepflanzte
markante Bäume, Feldkreuze,
Steinblöcke o. ä. Flüsse durchquerte man an seichten Stellen,
Sümpfe umging man möglichst komplett. Die Ortsverbindungswege führten nicht selten geradewegs hoch über
Anhöhen und von dort wieder steil nach unten zum nächsten Ort.
Nicht unbedeutend für den Warenverkehr und wichtige Anlaufstellen für die Fuhrleute waren die an den Handelswegen liegenden Dörfer und Weiler. Sie beherbergten Schmiede, Wagner, Sattler, Seiler u.a. Handwerk - oft brachen an den Wagen während der Fahrt Räder und Achsen oder Ketten und Spannzeug. Von Bedeutung
waren auch notwendig
werdende Vorgespanne an Steilstücken oder bei Morast.
Meist waren dies Ochsengespanne. (In den Ställen der Bauern
standen - neben Kühen, meist Stiere oder Ochsen,
Pferde nur in seltenen Fälle (waren teuer und unnötige
Fresser, die Pferdegeschirre fast unbezahlbar) Wichtig
zu nennen sind
hierbei auch die Gasthäuser und Herbergen am Weg. Die Fuhrleute und
Transportiere brauchten Ruhezeiten, Futter, Essen und Trinken. Dann
wurden in früher Zeit ein Großteil der Waren und Gegenstände -über
oft lange Strecken, auf dem Rücken oder Handkarren zu Fuß transportiert.
Man denke an die zahlreichen Wanderkrämer, Frucht – und Schmalzträger und Botengänger. Gasthäuser und Herbergen
waren überlebenswichtig.
Die Reichsstadt Gmünd mit ihren Klöstern – ihre
Einwohnerzahl in etwa wie die Reichsstädte Aalen und Bopfingen
und der Probsteistadt Ellwangen zusammen genommen,
hatte einen großen Bedarf an Eisenprodukten aus dem Eisenwerk in Abtsgmünd und Waren wie Fische,
Kirchenartikel, Holz, Kohle
u.a. aus der Fürstprobstei
Ellwangen selbst. Der
Birkbauer, ellwangischer
Untertan, erhebt im Streit mit der Gemeinde Heuch-lingen
wiederholt die Klage, dass Fuhrknechte mit ihren Fuhrwerken verbotenerweise
von den gesetzten Fahrwegen - also den offiziell vorgeschriebenen
Wegenen- abweichen und dabei über seine Grundstücke fahren würden. Die
Sache wurde im Apr. 1670
auf dem Birkhof vor dem damaligen ellwangischen Oberamtmann Johan Friedrichen Lang von Leinzell
verhandelt und hierzu die beteiligten Fuhrknechte befragt und
verhört. Dabei ging es vornehmlich um Warentransporte aus der Fürstprobstei Ellwangen und "Eisenfuhren"
aus dem Eisenwerk Abtsgmünd, jeweils
in die Reichstadt Gmünd (und das umgebende Umland im Remstal).
Die gestellten Fragen an die Fuhrknechte ergaben dabei interessante Einblicke in die verschieden eingeschlagenen Fahrrouten und der Beladungen,
aber auch Einblicke in den Zustand der Wege und deren zeitweisen Unbefahrbarkeit. Dabei bedurfte
schon einen guten Orientierungssinn
um sich in der Landschaft zurechtzufinden. Man beachte, es
gab keine Wegweiser, Ortstafeln und Ortsschilder,
geschweige denn Landkarten. Die Ortsein-
und Ausgänge ließen sich oft nur schwer erkennen. Diese erforderte
gute Ortskenntnisse. Verhöraussagen
- gekürzt (Verhöre spielten im Jahr 1670 - Originaltexte s. Rathaus-archiv Hchl.) Hans
Schurrer zu Unterböbingen, ~ 76 Jahre alt, sagte aus: Zum Ersten: dass er mit seinen Eisenfuhren von Abtsgmünd nach Heuchlingen, von dort auf den Brackwang, dann von dort nach Unterböbingen beim Schlösslein herab und weiter nach Gmünd gefahren sei. Auf dem gleichen Weg habe er des Öfteren das Eisen dem Eisenkrämer Herrn Bürgermeister Jöhlin und dem Söckler Kaspar selig
gebracht. Zum Zweiten: Das kleine Kohl (Kohlenreste und
Kohletrümmer) das man auf der Schmiede
in Abtsgmünd nicht
mehr gebrauchen konnte und das der Schmied in
Unterböbingen gekauft hat,
habe er dem Schmied gegen den Fuhrlohn angefahren. Wenn er in Abtsgmünd Schindeln geholt habe, sei er ebenfallss
den genannten Weg gefahren.
Solchen Weg habe er auch schon
vor und nach der Nördlinger
Schlacht (1634) gebraucht und darin gefahren. Zum Dritten: Seien sie das eine oder andere mal von Heuchlingen auf den Birkhof zu gefahren, aber helingerweise (heimlich), und auch etwa aus Nachbarschaft
- also gutmütigerweise, habe
man sie etliche mal
passieren lassen. Aber es sei dies nicht rechtens, da man, wenn
man von Hchl.
aus dem Birkhof zufahre, verbotenerweise über des Mederbauern Wiese fahren müsse. Schurrer gab
ergänzend hierzu an: Von
Unterböbingen
hinauf gegen des Brackbauer Viehwaid zu, habe es im Fahrweg
etliche grundlose und böse Gruben gehabt. (also tiefe und grundlose
Fahrrinnen) Herr Baumhauer, gewesener Gemeindevogt zu Bargau, habe dem Unterböbinger Amtsuntergebenen angeordnet, dass er
Steine in diese gemeldeten Gruben und Löcher
fahren und ausbessern lassen
müsse bis hinauf zu des Brackbauern Viehwaid und an das Heuchlinger Grubenholz, da sie, die Unterböbinger, dort Trieb und
Trab haben (Trieb und Trabrecht) ……. Michael Fux,
63 Jahre, der bei seiner Mutter in Unterböbingen
hauste, gibt zu Protokoll, Fux kann sich aber nicht erinnern, jemalen
über den Birkhof gefahren
zu sein. Intern: wie laute die Wegführung
v. Abtsgmünd nach
Reichenbach? Dann von dort: über
den Riegelhof, Lusthof, um Holzleuten herum zum Grubenholz ? ……. Wolf App, von Unterböbingen,
etwa 66 Jahre alt sagt, vor der Nördlinger Schlacht
(1634) habe er noch
bei seinem Vater in Reichenbach gelebt, der dort Gmündtischer Schulthteiß
gewesen sei. Er sagt zum Ersten: Wenn
sie in Abtsgmünd Eisen
geholt haben, hätten sie es dem Bürgermeister Jöhlen
selig gebracht. Dabei seien sie mit den Eisenfuhren von Abtsgmünd auf Reichenbach
zu gefahren, von da auf den Brackwang , weiter nach U.böbingen
beim Schlösslein
herab, und weiter nach Gmünd. Zum Zweiten: Wenn
der Weg aber gut (befahrbar)
gewesen sei, so seien er und sein Vater
von Reichenbach auf Mögglingen zu gefahren und weiter nach Gmünd. Zum Dritten: Zum
Vierten: Wann sie mit ihren
Güterwagen von Dinkelsbühl oder ihren Fischwagen
von Ellwangen nach Gmünd gefahren seien, hätten sie in Onatsfeld zum erstenmal Zoll für den Grafen von Öttingen zahlen
müssen, danach den Zweiten auf dem Zollhof oberhalb
Mögglingen den
Wöllwarths. Den
dritten Zoll dann in Mögglingen
und den Letzten zu Unterböbingen. ….... Jakob Beyrlin oder Kuab genannt von Mögglingen und ungefähr 75 Jahre, sagt
Erstens: Zum Zweiten: Auf der Hochstraß habe keiner
hinunterfahren dürfen. Wenn einer helingerweis (heimlich) hinter gefahren und ihn der
Flurer (Feldschütz)
erwischt habe, so habe dieser
einem die Wagenketten abgenommen
oder man mit dem selben
auskommen (klarkommen, bezahlen) müssen. Zum Dritten: Wann sie Güterwagen
von Dinkelsbühl oder Fischwagen
von Ellwangen nach Gmünd gefahren, haben sie
den gesetzten Weg (den vorgeschriebenen
Weg) genommen nämlich: Von Ellwangen auf Schwabsberg zu, von dannen auf Hüttlingen, von Hüttlingen auf Onatsfeld
und von dort auf Hammerstatt.
Von Hammerstatt auf den Zollhof, von dort nach Mögglingen, weiter nach U. Böbingen
und weiter Gmünd zu. …......... Jacob
Fischer zu Mögglingen, ungef. 70 Jahre sagt aus: Wann sie mit Eisenfuhren von Abtsgmünd
seien nach Gmünd gefahren , seien sie von Abtsgmünd
auf Reichenbach, von dannen an des Haidenbauern von Holzleuten Holz ( Haidenbauers Wald), und neben dem Bibert herab,
unter dem Breitenberg herunter auf
Mögglingen, von
dort auf Unterböbingen und weiter Gmünd zu gefahren. Auf der Hochstraß habe keiner hinunter fahren dürfen. Wenn
einer dann doch helingerweise (heimlicherweise)
hinuntergefahren sei und ihn
der Flurer (Feldschütz)
verwischt (erwischt) hat, so habe dieser einem die Spann-Ketten abgenommen, oder man habe mit
demselben anders auskommen (klarkommen) müsse. Für Güterfuhren
von Dinkelsbühl - oder Fischwagen von
Ellwangen nach Gmünd seien alle gegen Mögglingen, Unterböbingen
und auf Gmünd zu gefahren. ….........................
...........................…. ............................. Fischerweg
– oder Fischtransporte von Ellwangen i.d. Reichstadt Gmünd Der Fürstprobst Ellwangen besaß im 17. – und der ersten Hälfte des 18. Jh. bis zu 80 besetzte Fischweiher
und Fischgruben. Aus diesen
Fischweihern nun konnte der große Bedarf an Fischen
der umliegenden Klöster, so
auch der Klöster in Gmünd
, befriedigt werden.
Dabei sprechen beide
Berichte vom „Fischerweg", meinen aber, einmal
die Wege der Fuhrwerke mit den Fischfuhren - zum Andern
die Wege der Fischträger,
also deren Wegerouten. Wobei auch hier - also in beiden Fällen, gilt:
"Den Fischerweg" gab es nicht, allenfalls „Fischerwege" -------
…. Noch offene Fragen <
Die agierenden Fuhrknechte waren offensichtlich (z. Tl. abwechselnd) in und aus versch. Gemeinden
im Dienst. Wer waren deren Dienstherren? größere Bauern, Schultheißen
o.ä.? Wie kamen diese zu solchen Fahraufträgen oder wer vergab
sie? Hier muß noch reche-rchiert werden. < Die Fuhrleute
fuhren, je nach Standort
ihres Heimatstalles und ihrer Ortskenntnisse, verschiedene Routen, abhängig auch von den
Jahreszeiten, dem Wetter und dem jeweiligen Zustand der Wege. Es gibt
noch
weitere
offenen Frage betreffs der "Eisenfuhren"
nach der Reichsstadt Gmünd und dessen Umland. <
Was hatten die Fuhrleute auf ihren Wagen? waren es noch ungeschmiedete Eisenluppen? oder schon vorgeschmiedete
Waren? In welcher Form lagen diese vor? <
Ist die Fertigungsart zur Eisengewinnung in Abtsgmünd im Jahr 1670 noch bekannt? Waren Schachtöfen
und Herdöfen oder schon Vorformen von Hochöfen im Einsatz? <
War parallel zur Eisengießerei schon eine Eisenschmiede im Betrieb
(Altschmiede) oder entstand diese erst später? |