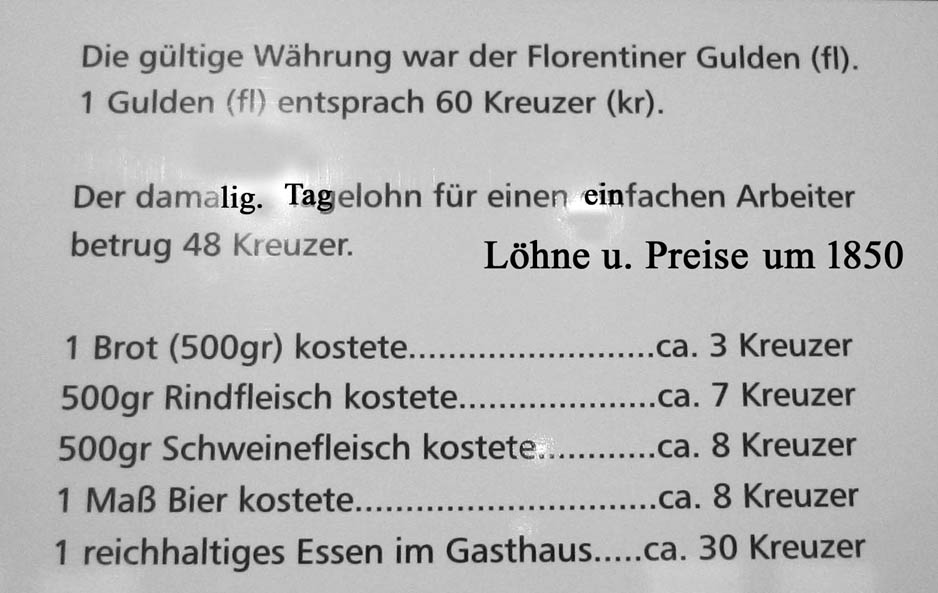|
Obereramt Heuchlingen – Dorfordnung
– Dorfgemeinschaft - Dorfleben. .. Heuchlingen bildete das
zuletzt gebildeten Oberamt. Diese
Struktur sollte dann bis in das Jahr 1803 andauern. > Das Oberamt
Heuchlingen bestand aus den Gemeinden Heuchlingen, mit ihren Gehöften (Holzleuten war Lehenvergaben
der Klöster in Gmünd- ausgenommen das Hofanwesen „Strohbauer“ welcher d.
Schloss Hchl. angehörte) > Die
Herrschaft Wöllstein mit ihren Waldgebieten und Sägemühlen. > und die
Gemeinde Abtsgmünd, ebenfalls mit seinen Korn - u. Sägemühlen und dem Eisen-
Hammerwerk.
(angemerkt: hier wurde u. a. Stabeisen für die Nagelschmiede im Gmünd,
Mögglingen u.a. Orte vorgehämmert.) < Sitz des
adeligen Oberamtmannes war das Schloß Heuchlingen (zeitweilig)
-- … Heuchlingen
- sozialer
Aufbau - Schichten, Stände zu Anfang des 19. Jh. Eine Übersicht: Zu Anfang des 19. Jh. standen in Heuchlingen annähernd 72
bis 75 Hausanwesen (mit etwas mehr Wohneinheiten). Zusammengesetzt aus
ca. 8 Bauern, ~ 50 Seldner - und
Lehneranwesen
und ca. 15 Häusleranwesen der Taglöhner, Handwerker u. a. Einige der letztgenannten Häusler / Hanwerker-
Anwesen seien genannt: 2 Bäcker
- den Wägnersbeck (Hs.16) u. d. Beckamichele (Hs. 54); 1 Bader - i. Hs. unterhalb
d. „Badquelle“; mind. 2 Zimmermanns- Familien - den Zimmermstr.
Holl u. die Zimmerersippe Schönberger; mind. 2 Maurersippen wie: die "Tonismaurer"
Wanner / Werner i. Hs. 19 u. die Maurersippe Krehwedel i. Hs. 35; mind. 1 Schmied - d. Schmied
Kuhn i. Hs.
25; mind. 2 Hirten u. Hirtenhäuser i. d. Hirtengasse
100. i. Hs. 76 u. Hs.
64/65 a. d. Kirchbühl; 1
- 2 Gänsehirten a. d. Gänsbühl; mind. 2 Schneider, "Beckenschneider"
Jh. Hägele i. Hs. 15 u. d. „Stöffele“-Biehlmaier, a. d. Kirchbühl Hs.
102; 1 Dorfbüttel;
1 Feldschütz;
event. noch 1– od. 2 Nachtwächter; mind.
1 Krämer,
d. Nikolai Ohnewald i. Hs. 86; 1 Käser; 1
Abdecker („Schinder“ – u. a. d. Keartschwarz)
1 Schultheißenhaus
im alten Haus (vermutl. Hs. 26); 1 Mühle; 2 Gasthäuser.
Hinzu kommen noch:
~ mind. 2 Hofstellen a. d. Brackwang, 2 Hofstellen auf dem großen-
und 1 bis 2 H.S. a. d. kleinen Mäderhof, 1 Hofstelle a. d. Birkhof,
1 H.S. a.
d. Riedhof u. 1
Haus im Stöckach, 1
Hs i. Kiart und 1 Hofstelle in Hlzl. („Strohb.) Aufbau
und Verwaltung der Gemeinde Heuchlingen im 18./19. Jh. An
der Spitze der Gemeinde- Hierarchie standen: Der
Schultheiß.
Er wurde vom jeweiligen Landesherren eingesetzt
und hatte dessen Interessen zu vertreten. Er war
verantwortlich für den weltlichen Teil– die weltlichen Belange
in der Gemeinde. Er war Richter der niederen Gerichtsbarkeit, Steuerneintreiber, Amtsschreiber, verantwortlich
für d. Steuerung d. herrschaftl. Frondienste,
u.s.w. -- Vielleicht interessant: ein
Vorfall aus der königlich Wrttb. Herrschaft: auf
Martini 1817 (11. November) legte Herr Schultheiß Trettner das Acciser-Amt
freiwillig nieder, welches dann ich (Josef Ohnewald) erhielt – Der
Anlass: Nach einer Prüfung durch Beamte des Oberamtes wurde der rückständige
und schleppende Steuereinzug durch den Schultheiß Trettner beanstandet.
-- Quelle: Aus d. Tagebuchaufzeichnungen
von Josef Ohnewald. Neben dem Schultheiß
wäre dann zu nennen: Der
Dorfpfarrer- das Pfarramt --
war für die sittlichen - und
kirchlichen Belange in der Gemeinde verantwortlich. ----
Wissenswertes hierzu: Nach der Einvernahme der Fürstpropstei Ellwangen in das neu geschaffene wrttb. Staatsgebiet „Neuwürttemberg“ im Jahr 1803,
ordnete König Wilhelm die Einführung der Kirchenkonvente auch in den
katholischen Landedesteilen Neuwürttembergs an. "Da wir von der Zweckmäßigkeit derselben (d.
Kirchenkonvente) für die Einhaltung äußerer Ordnung und für die Beförderung
der Religion und Sittlichkeit, sowie für die Geitlichen uns überzeugt
halten" (Reyscher-Bd. 10 S. 504f. (ZWL Jg. 49) Dieses Kirchenkonvent
in Hchl. bestand aus
4 ehrbaren Dorfleuten (i. d. Regel Bauern) und dem Dorfpfarrer
als Vorsitzender dieses Konvents. Konventsitzungen
mussten alle 4 Wochen (urspr. 14-tägig) abgehalten werden. Hierbei
wurden alle, die Kirchenzucht betreffende Geschehnisse
im Ort, untersucht und die zu verhängenden Strafen verhandelt. Konkret
verhandelt wurden: Versäumniss des sonntäglichen Gottesdienstes,
Wirtshausbesuche während des Gottesdienstes, Ehebruch, nichtehel.
Geschlechtsverkehr, Ehestreitigkeiten, nächtliches Lärmen, Sauferei,
Tanzvergnügen, abhalten von Lichtstuben u. vieles mehr. Die Bevölkerung
war angehalten, derartige Geschehnisse dem „Konvent“ zu melden. An
Strafen wurden ausgesprochen wie: Nennung von der Kanzel, sowohl der
Person, wie auch das Vergehen. Bei Geldstrafen wurde die anzeigende
Person mit einem Teil der Geldstrafen, oder anderweitig belohnt. ……………. …………………. Dorfverwaltung
und Dorfordnungen Die bürgerliche Gemeinde konnte - unter Kontrolle des Schultheißen (also der Herrschaft)- ihre Angelegenheiten weitgehend selbst verwalten. Sie besaß das Recht, in der Gemeindeversammlung für alle Dorfbewohner verbindliche Satzungen aufzustellen und deren Befolgung auch durchzusetzen. (z.B. Bußgelder) Solche Satzungen wurden oft in einer sogenannten „Dorfordnung“ festgehalten. (es findet sich v. Hchl. keine) Der Umfang eine solchen Dorfordnung war oft noch untergliedert in Waldordnung, Hirtenordnung, Ruggerichtsordnung, u.s.w. In Selbstverwaltung
erfolgte dann Regelungen zur geordneten Flurnutzung im Zuge der Dreifelderwirtschaft,
Vergabe und Verteilung der Allmenden, Festlegung des Schäferzugs durch
die Fluren, die Pferchvergabe und der Pferchverkauf u. mehr.
---- Als personellen Angelegenheiten
können genannte werden: Wahl und von Dorfhirten, Nachtwächtern - oft
in Verbindung mit Feuerschau u. Brandschutz. Die Ernennung von Feldschützen
und Feldvermesser. Planung der Frondienste, Aushub und sammeln von
Leinsand und Leinkies – und dessen Verkauf (für den Häuserbau damals),
und vieles mehr. …. Aufbau und Verwaltung der Bürgergemeinde Heuchlingen – in der Fürstpropstei Ellwangen und *Neuwürttemberg
- *wie das ehem. Gebiet der Fürstpropstei
Ellwangen, der versch. Grafschaften u.a., nach der Eingliederung in das
Königreich Wttb. Bezeichnet wurde. Dabei liegen für die ellwangische Zeit derzeit keine detailierten
Kenntnisse vor. Der personelle Aufbau: Erster Gemeindebeamter war der Schultheiß -
in 1826/27 war es Melchior Trettner. Die weiteren Angestellten: Der rechnungsführende
Bürgermeister oder Accieser, (der
Steuer-eintreiber). Danach war es der Gemeinderechner (Gemeindepfleger) -
(jener Zeit -1826/27- Josef Ohnewald), welcher f. d. das Kassen- und
Rechnungswesen zuständig war. Der Gemeindepfleger durfte jedoch nicht
gleichzeitig Ratsschreiber sein; der Fronbürgermeister - er war i.d.
Regel im Gemeinderat vertreten (1. Gd.Rat); ein
Polizeidiener - in jener Zeit Bernhard Holl; ein Flur- oder Feldschütz
= 1826 Bernh. Kaiser, 1827 M. Hudelmaier -- 1813 noch Flurer genannt; dan ein
Nachtwächter - Anton Burghardsmaiyer; ein Dorfhirte
/Gänsehirte - dieses Thema ist in einem gesonderten Blatt dargelegt. Nicht
mehr aufgeführt sind: ein Abdecker, auch Kleenmeister genannt, ein Dorfhirte für die Schweinehütung und ein
Totengräber. .................. Untergänger:
Überwachung der Feldgrenzen, Feststellung u. Berichtigung der Marksteine
usw. Viehschauer und Brod - und Fleisschauer
- auch Brod - Bier - und Fleisschauer bezeichnet. Feuermeister - Rottmeister = Anführer
einer Feuer-Rotte - meist 10 Mann stark. Localfeuerschauer
für halbjährl. Visitation Kaminschauer (Kaminfeger) – extern Sie beziehen keine Besoldung,
sondern nur die Commun-ordnungsmäßigen Taggelder. .............. Gemeindebedienstete mit Allmandbesoldung
und anderes. Bei der Allmendteilung im Jahre 1804
wurden einen jeweiligen Pfarrer - Schultheiß und Schullehrer
zu Hchl. jedem 6 Alllmandteile,
Für eine Hebamme allhier aber 5 Allmandteile zur Nutzung vorbehalten - s. sep. Thema "Wobei die 23 Allmandteile an verschiedenen Orten gelegen
sind, und wovon das Grundeigentum der Gemeinde zusteht" ................ Besoldungen
- Beispiele Die
jährliche Besoldung in 1826/27-scheint gering. Dabei wurden aber gesonderte
Einsätze, wie z.B. die einzelnen Sitzungen, Botendienste u.s.w. jeweils mit
Taggelder entlohnt. Diese betrugen in jener Zeit ca. 24 Kreuzer.
Verdienst
- Beispiel gegenüber gestellt: 1860 fertigt der Schuhmacher Vitus Weber
im Auftrag der Gemeindepflege Hchl. für die arme Josepha Vogt v. hier ein Par
Schuhe und bringt |