Wasserversorgung
in Heuchlingen im 18. Jahrhundert bis hinein ins 20. Jahrhundert.
Im Gegensatz zu manch anderen
Gemeinden - zum Beispiel in manchen Dörfern auf der Alb. Diese waren
überwiegend auf Wasser aus Zisternen, aber auch aus Teichen und Bächen
angewiesen. Oft musste das Wasser aus entfernten Orten mit Fuhrwerken
angefahren werden. ……………….. …………………. Wasser – Versorgungssysteme 1. Schachtbrunnen, in der Funktion als Zieh - Pumpbrunnen oder Schöpfbrunnen. 2. Lauf - und Trogbrunnen 3. Reine Schöpfbrunnen. Das Wasser wurde aus niederen Sammelschächten oder Quellgruben geschöpft 4.
Hierbei darf auch der Leinfluss als wichtige Wasserquelle zur
Viehversorgung - vor allen der Talanwohner- nicht unerwähnt bleiben. Schachtbrunnen wurden von gelernten Brunnenbauern in einer speziellen
Grabe- und Ausmauerungstechnik erstellt. Diese Arbeit war nicht ganz
ungefährlich. Die Schächte waren nicht selten 10 und mehr Meter tief.
Teilweise wurden statt der Ausmauerung auch Bohlen verwendet. Man sprach dann
auch von einem Brunnenkorb. Hier ist vieleicht interessant: in alten Heuchlinger Kirchenbüchern
deuten „Übernamen“ wie, Gruber, Grubenmichel, Grubenfranz u.a., auf
die Tätigkeit des Brunnenbauens hin. Mitte
des 19. Jahrh. kamen dann sogenannte
Schwengelpumpen zum Einsatz. Diese schafften aber nur eine Schöpftiefe von
maximal 8 Meter.
. . Das
Bild hier zeigt einen alten Pumpbrunnen
Das Schöpfbrunnensystem war gleich dem der Laufbrunnen. Das
gefasste Quellwasser hat man in bodengleiche gemauerte Wannen und niedere
Schächte geleitet. Aus denen wurde das Wasser dann mit einer
sogenannten Schapf in Eimer u.a. Behältnisse geschöpft.
Beispiele
Schachtbrunnen
mit einer Seil-Haspel
(Rolle)
Schachtbrunnen
mit Schwengelpumpe
|


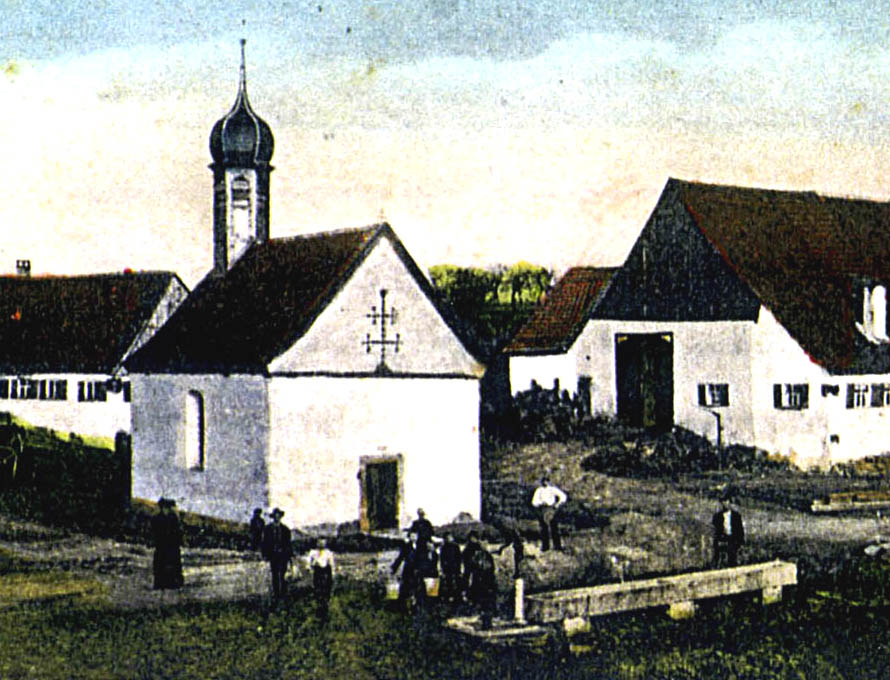
 Laufbrunnen
mit Brunnenstock
Laufbrunnen
mit Brunnenstock