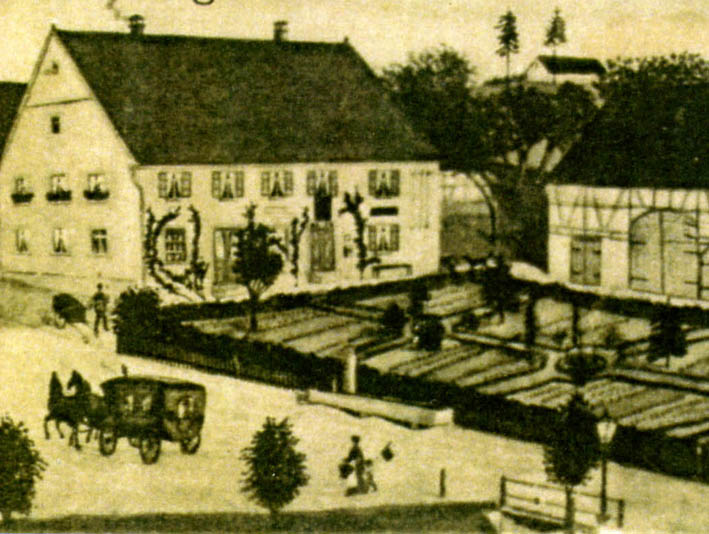|
Brunnen in Heuchlingen
..............................
Die Brunnen rechts der Lein
Legenden: rote Punkte: Quellfassungen – Reservoire, blaue Punkte: Brunnenstandorte
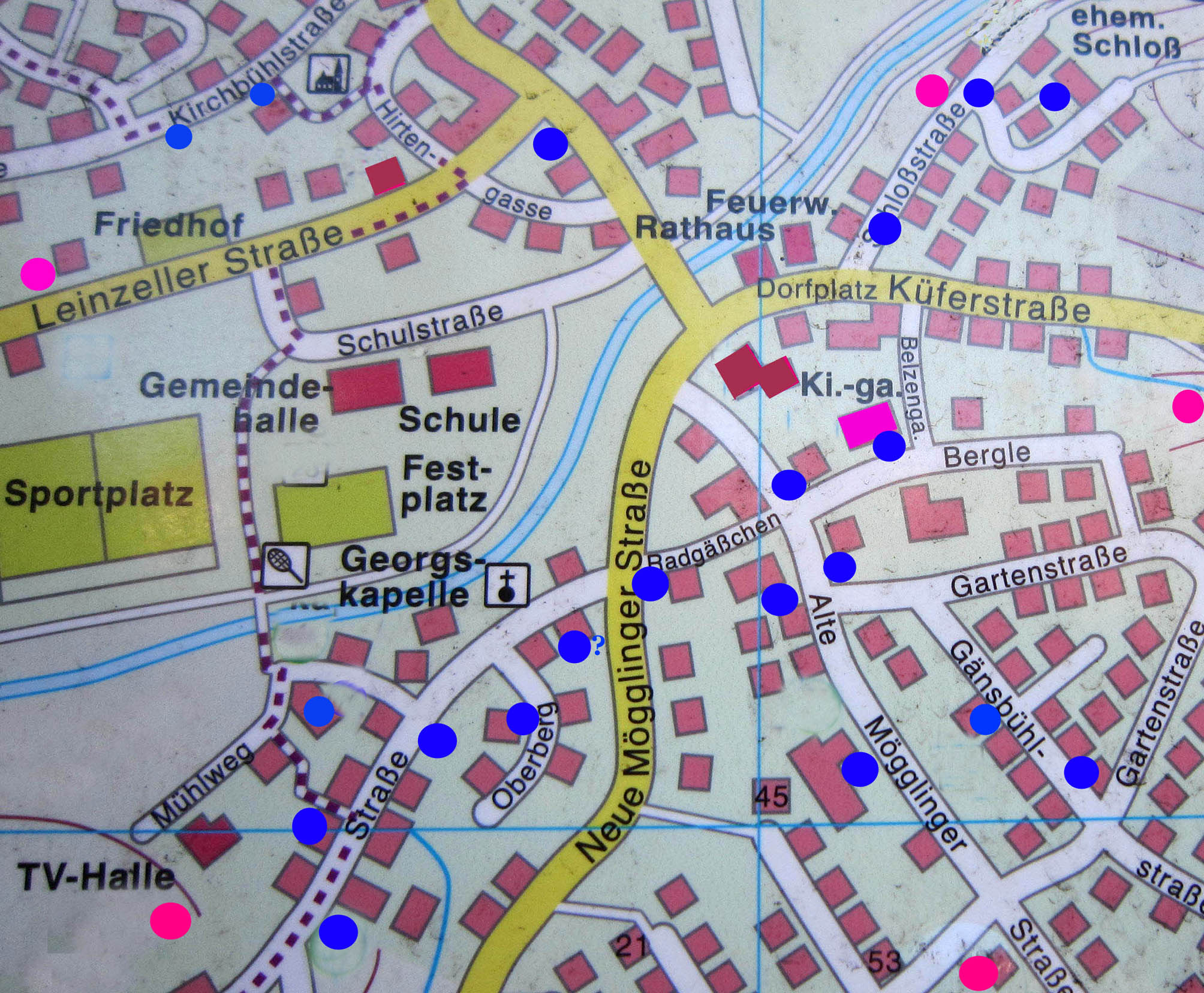
Brunnentour
Die Brunnentour beginnt
im Schloßhof, führt die Schloßgasse hinunter zur Küfergasse
und vor zur Alten Mögglinger Straße, macht einen kleinen Schwenk hoch
zum Bergle, geht zurück, weiter über den Gänsbühl, den "Hohengartenberg"
hinunter und weiter zur Vorstadt. Dabei werden wir auf rund 19 Brunnen
oder Brunnenanlagen stoßen.
Schachtbrunnen im Schloßhof
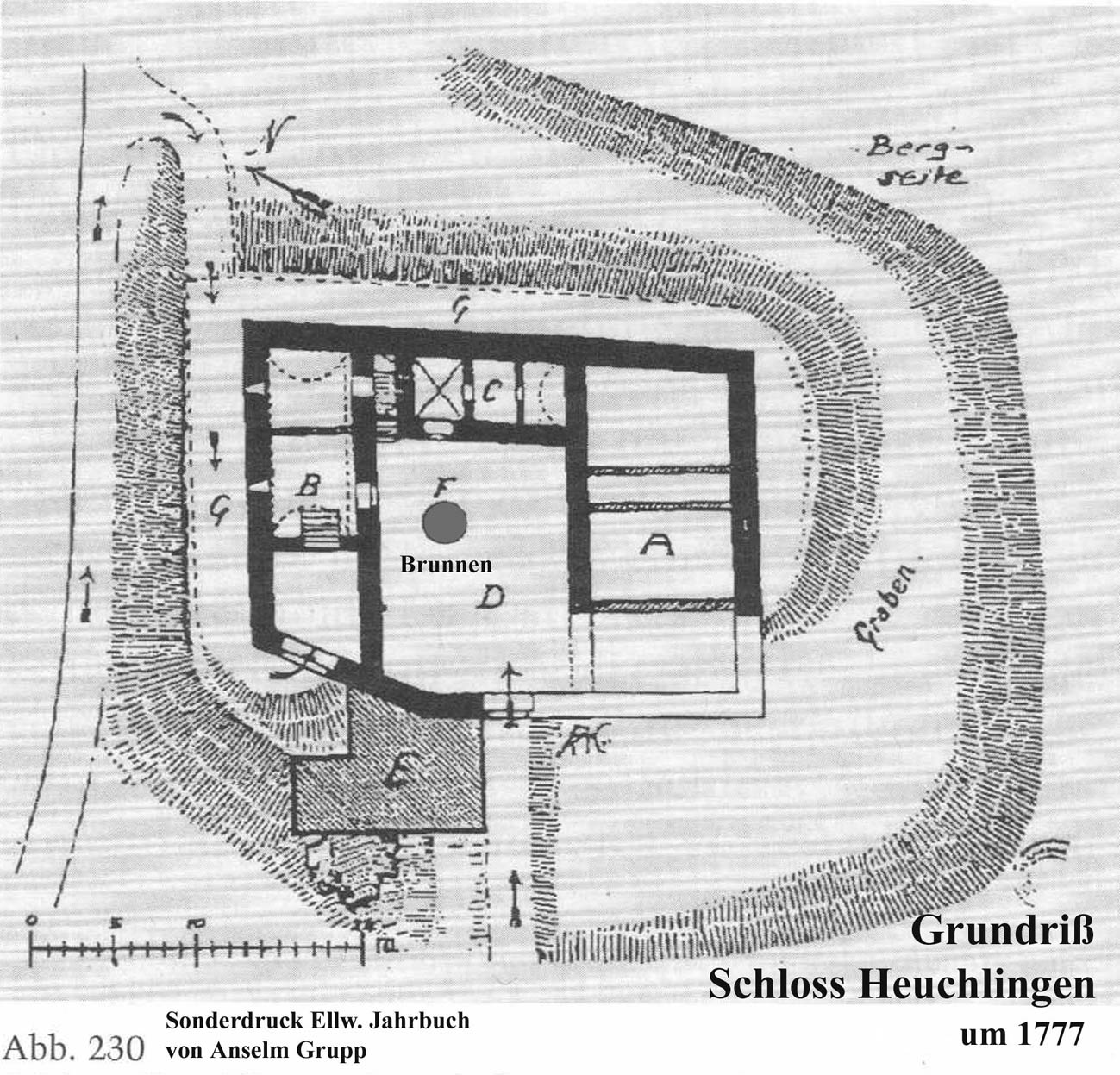 Mitten im Schloßhof
befand sich ein tiefer Schachtbrunnen. Noch lebende Zeitzeugen wissen
von dem Brunnen allerdings nur noch aus Erzählungen ihrer Eltern und
Großeltern. Auch wie lange der Brunnen im Gebrauch war, ist unbekannt. Mitten im Schloßhof
befand sich ein tiefer Schachtbrunnen. Noch lebende Zeitzeugen wissen
von dem Brunnen allerdings nur noch aus Erzählungen ihrer Eltern und
Großeltern. Auch wie lange der Brunnen im Gebrauch war, ist unbekannt.
Nach Hans Bihlmaier war
früher bei Regenwetter ein runder Abdruck der Schachtausfüllung immer
deutlich zu erkennen. Und zwar als eine Art großes Kreuz in der vermuteten
Schachtmitte- vieleicht noch ein Rest der Bohlenabdeckung. Dabei schätzt
er den Durchmesser des Schachtes auf 2 m oder größer ein.
Etwas zur Tiefe
des Brunnenschachtes: In Recherchen von Pfarrer Zeyer sprechen Zeit-zeugen
von einer Tiefe bis zur Talsohle - eher nein! Sicherlich reichte sie
aber bis zur Sandstein - Felsformation der Brunnenstube für den Badbrunnen.
Neue Erkenntnisse:
Zu diesem oder diesen Brunnen im Schloßhof gibt es nun aber neue
Erkenntnisse. Zu lesen sind sie in dem Sonderdruck des Ellwanger Jahrbuchs
2006/2007, Band 41, S. 384 386.
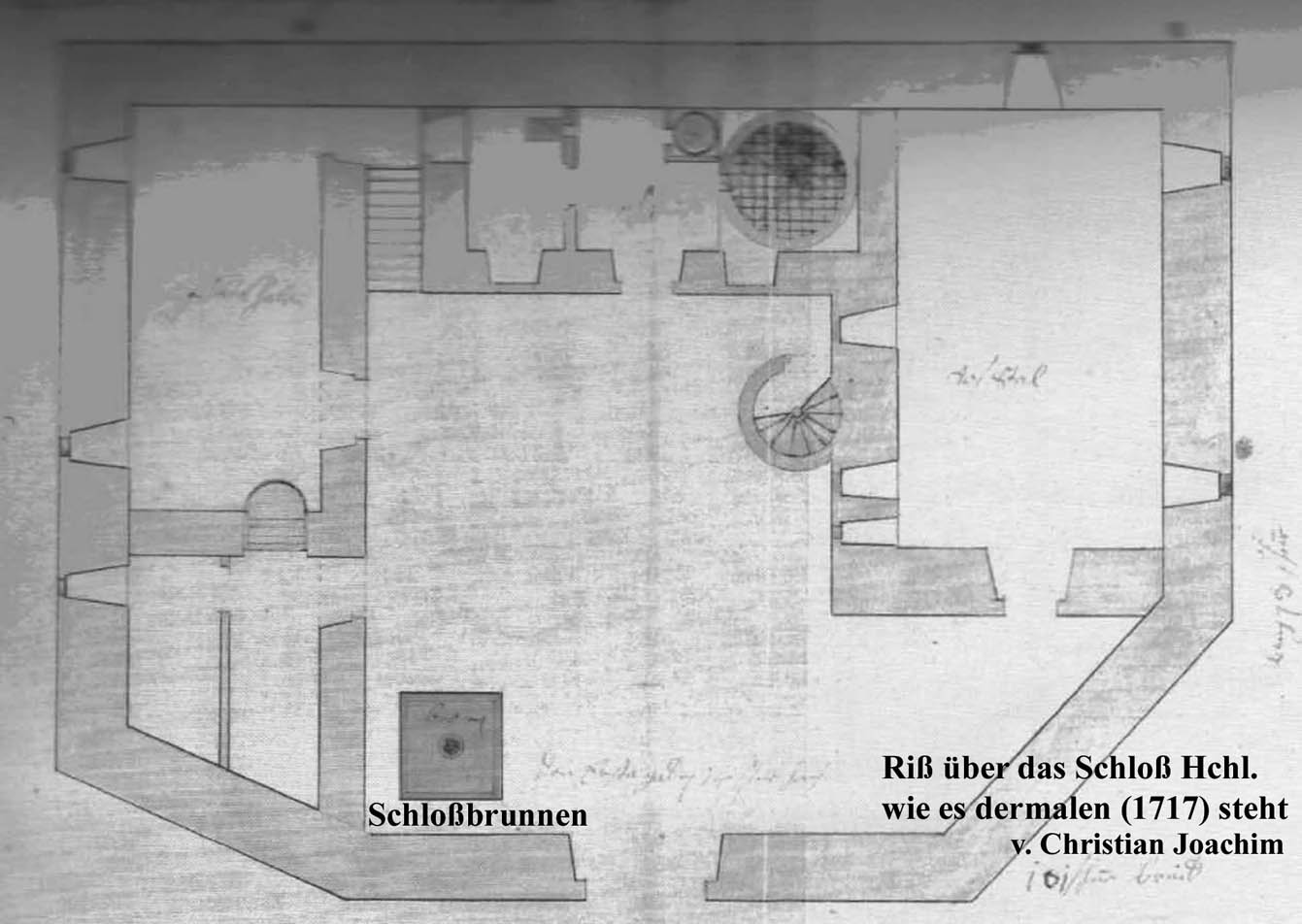 Hintergrund: Im
Jahr 1717 hat man geplant, das Schloss in Hchl. als Oberamtssitz - 1
von insgesamt 6 O/A im Ellwanger Herrschaftsgebiet - neu zu gestalten,
was aber nie zur Durchführung kam. Hintergrund: Im
Jahr 1717 hat man geplant, das Schloss in Hchl. als Oberamtssitz - 1
von insgesamt 6 O/A im Ellwanger Herrschaftsgebiet - neu zu gestalten,
was aber nie zur Durchführung kam.
..................
Ein Christian
Joachim beschreibt nun in seinem Umbauplan von 1717 den vorgefundenen
Bauzustand so: Dem Südtrakt zum Hof ist ein
runder Treppenturm vorgebaut. Auch lässt sich der Schlossbrunnen
anhand eines Grundrisses im westlichen Hofbereich lokalisieren. siehe
hierzu nebensteh. Abbildung
1777
dann, fordert der damalige Amtsschreiber Gottfried Canaris den Bau
eines Brunnens. Mit diesem Vorhaben wurde ein Johann Hagenlocher beauftragt.
Die Position des Brunnens befand sich ungefähr in der Mitte des Schloßhofes
- siehe erste Bildansicht. Frage: war der
1717 beschriebene alte Brunnen nicht mehr nutzfähig oder eingestürzt?
Weiterer Schachtbrunnen
auf dem Schlossberg? Nach Meinung von Xaver Beirle befand sich wenige
Schritte hinter dem Haus Arnold, dem Hang zu, ein weiterer Schacht-brunnen.
Hans Bihlmaier räumt die Möglichkeit eines Brunnens dort ein, kann sich
konkret aber nicht daran erinnern.
Pfarrer Zeyer recherchiert dann auch eine Schloss-Versorgungsquelle
im Schloßgarten und noch eine *Quellzuführung aus dem weit entfernt
liegenden Wald des Franz Ilg auf der nördlichen Leinseite. s. Pf. Archiv,
Krt. 32 (*ist unwahrsch.)
Ein Schachtbrunnen
im ehem. Schloßgarten?
 Albrecht Bucher erzählt
im Dez. 2011 von einem Brunnenschacht hinter dem Haus Pawlita - dem
Haus A. Bucher zu. Der Brunnenschacht kam bei der Ausgrabung des Hauses
zum Vorschein. Er war mit fachmännisch geformten Mauersteinen ausgemauert.
Zum Schacht hin führte ein Plattenweg, ebenfalls mit geformten Bodenplatten.
Den Brunnenschacht hat Alexander Pawlita bis zu einer Schachtiefe von
ca. 2 m wieder hergerichtet. Nach A. Bucher gibt es hiermit ganz eindeutig
auch einen Hinweis darauf, dass hier einst ein Gebäude gestanden haben
muss - bedarf ggf. näherer Recherchen. Albrecht Bucher erzählt
im Dez. 2011 von einem Brunnenschacht hinter dem Haus Pawlita - dem
Haus A. Bucher zu. Der Brunnenschacht kam bei der Ausgrabung des Hauses
zum Vorschein. Er war mit fachmännisch geformten Mauersteinen ausgemauert.
Zum Schacht hin führte ein Plattenweg, ebenfalls mit geformten Bodenplatten.
Den Brunnenschacht hat Alexander Pawlita bis zu einer Schachtiefe von
ca. 2 m wieder hergerichtet. Nach A. Bucher gibt es hiermit ganz eindeutig
auch einen Hinweis darauf, dass hier einst ein Gebäude gestanden haben
muss - bedarf ggf. näherer Recherchen.
………………
Schacht - und Pumpbrunnen am Aufgang zum Schloss
Im Jahre 1864
haben die Schloßberg - Bewohner der Häuser 1 bis 13
am Ortsweg Nr. 12 in der Schlossgasse auf der Parzelle 209/2 beim Haus
Nr. 7 einen Brunnen gegraben und einen Pumpbrunnen eingerichtet.
Die genannten Häuser 1 bis 13 betrafen alle Gebäude auf dem Schlossberg
bis hinunter zum früheren Haus "Maures-Schreiner"- heute Fam.
Gerkowski. Hier stellt sich jetzt die Frage :
war zu dieser Zeit- 1864, der Schachtbrunnen auf dem Schloßplatz
schon stillgelegt oder unbrauchbar?
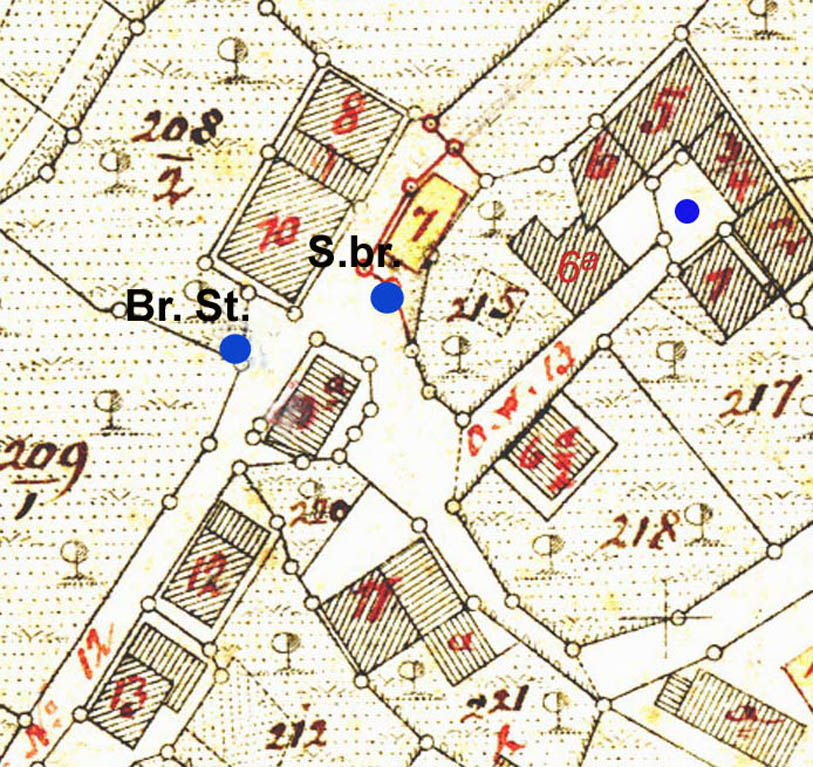
Legende zum Bild: Die mittlere
blaue Markierung auf dem Plan zeigt den wahr-scheinlichen Standort
des vor erwähnten Brunnens. Die blaue Markierung. rechts zeigt den Brunnen
im Schloßhof, die linke Mar-kierung den Standort der Brunnenstube
zum Badbrunnen am Aufgang zum Schloßberg
.
Massive Beschwerden:
wegen dieses Brunnens gab es dann immer wieder massive Beschwerden.
1902 stellt die "Wassernutzungsgesellschaft des laufenden Badbrunnens"
ein Ultimatum zur Stilllegung und Auffüllung des Pumpbrunnens, weil
über diesen Brunnen schädliche Abwässer und auch Gülle aus den dort
benachbarten Ställen in den Badbrunnen am Aufgang zum Schlossberg gelangen
würden. Hier kann man nun vermuten, dass der beanstandete Pumpbrunnenschacht
über dem Quelleinzug des Badbrunnens lag - es wäre dies die Brunnenstube,
nahe beim früheren Schlosswägnerhaus Nr.10 in der Parzelle 209/1- im heutigen Boppschen Garten.
……………… …………….. ……………….
Badstube - Brunnenstube - Badbrunnen
Geschichte
Schon in alter Zeit diente der Badbrunnen zur Wasserversorgung für Mensch
und Vieh in der gesamten "Küfergasse" und der Bewohner am
Schlossberg. Daneben aber auch zur Versorgung der Badstube
unterhalb der Brunnenstube in der Talaue.
Im Heimatbüchlein "750 Jahre Heuchlingen" steht:
Die bereits 1366 genannte
Badstube befand sich hinter dem früheren Haus von Gustav
Holstein und ehem. Pizzeria. In dieser Badestube waltete ein Bademeister,
allgemein nur Bader genannt, seines Amtes. Der Bader wurde von der Gemeinde
bestellt. Er war zugleich Wundarzt und Aderlasser.
Auch setzte er den Leuten Blutegel an. Diese kamen sehr reichlich am
Nägelessee vor. Davon zeugt noch der Flurname "Nägelessee, ursprünglich Egelessee, abgeleitet v. Egel.
Diese "Badstube" ist dann auch der Namensgeber für
die Quellfassung und den Badbrunnen.
Eingefügt
Ärztliche Versorgung im Mittelalter bis zur Neuzeit
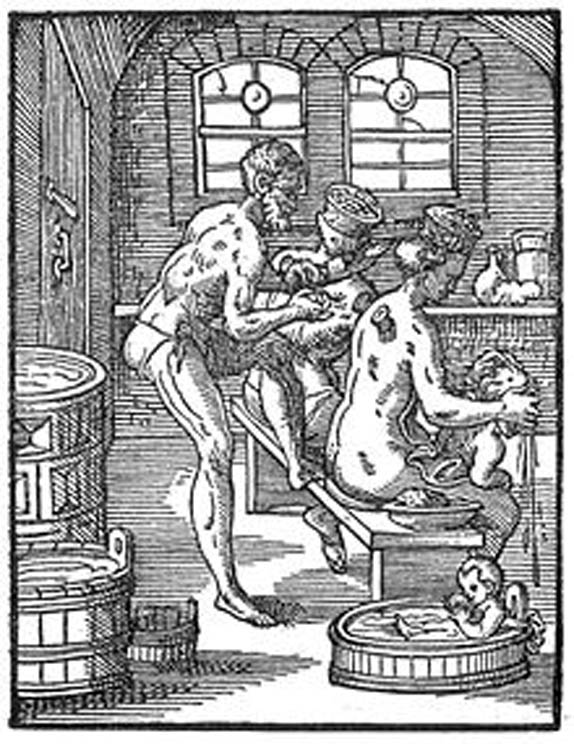 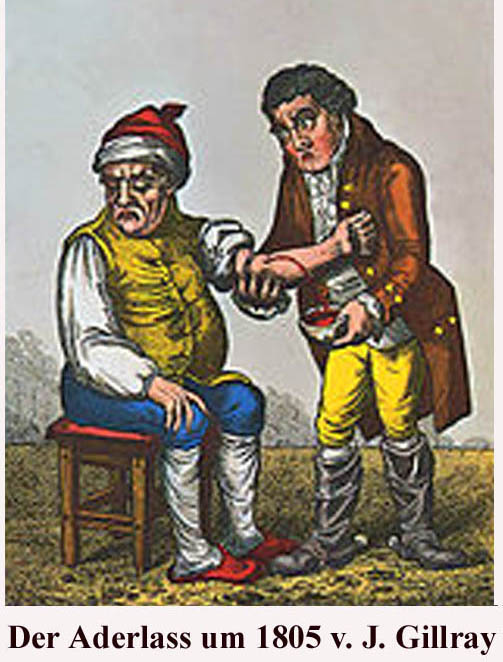
Neben den wenigen studierten Ärzten bildeten
im späten Mittelalter und der frühen Neuzeit die Bader, Barbiere, Scherer,
Wundärzte und Hebammen den Hauptanteil der Heilpersonen,
vor allem der armen Bevölkerung in Stadt und Land. Sie waren
die „Ärzte der kleinen Leute“ und übten einen hochgeachteten, Heilberuf
aus. Er umfasste das Badewesen, Körperpflege und Kosmetik, Teilgebiete
der Chirurgie, der Zahn- und Augenheilkunde, Kinderkrankheiten u.a.
......
Innere Medizin und Chirurgie
Die Aufgaben der Wundärzte und akademischen Mediziner, wurden
nach einem Beschluss des Konzils von Tour's
(1163) und des IV. Laterankonzils von 1215,
strikt voneinander getrennt. Die Chirurgie wurde als mindere Medizin
aus den Universitäten ausgeschlossen
Ebenso wie akademische Ärzte keine chirurgischen Eingriffe
vornahmen und mit Blut nicht
in Berührung kommen sollten, war es Wundärzten untersagt, Innere Medizin
zu betreiben.
.............
Bader - Barbiere- Wundärzte
Die Ausübung der praktischen Chirurgie im Mittelalter oblag
den in Zünften zusammen-geschlossenen Handwerkschirurgen. Je nach regionaler
Ausprägung waren dies die Bader, Barbiere und Wundärzte.
Bader
Die Bader durchliefen im Laufe der Zeit eine handwerkliche
Lehre Die Laufbahn vom Gesellen zum Meister war geregelt. Die Lehre
bei einem Meister dauerte drei Jahre.
Danach war eine dreijährige Wanderschaft und Ausübung des
Gewerbes bei anderen Meistern gefordert. Erst nach Ablegung einer recht
kostspieligen Meisterprüfung und eines Examens war dem Bader dann die
selbständige Berufsausübung erlaubt.
Heute werden Teile des Arbeitsspektrums der ehemaligen
Bader von verschiedenen Berufen (mit-) übernommen, etwa von Orthopäden,
Physiotherapeuten, Masseuren, Maniküren, Kosmetikern oder Heilpraktikern.
Wundärzte - Chirurgen
Hauptaufgabe der Wundärzte war, neben dem damaligen Allheilmittel,
dem Aderlass, die Versorgung äußerer Wunden. Außerdem behandelten Wundärzte
Abszesse, Hämorrhoiden, Verbrennungen und Krampfadern, führten Starstiche,
Blasenstein- und Bruchoperationen und Darmnähte durch, renkten Gelenke
ein, versorgten Knochenbrüche und zogen Zähne. Außerdem nahmen Wundärzte
Amputationen vor und stellten Prothesen her.
.........
Chirurgen und Wundärzte in Heuchlingen
In Heuchlingen lassen sich im 17. bis 19. Jh. 7 Chirurgen
und Wundärzte auszumachen:
<
Friedrich Kuhn,
Balneator (Bader) vom Mederhof, * ~1685, oo 1715 die Margaretha
Vogt ...von Hlzl. - Dr. Reg. 185 - <
Friedrich Kuhn ,
Balneator, der. Sohn, *1722,
oo 1747 Maria Sturm v. Hlzl. - Dr. Reg. 185 - <
Johann Kuhn, Bader, Sohn des Friedrich, * 1751, oo
1780 Rosina Leßle v. Hchl. - <
Franz Eisele, Chirurg in Hchl.,
* 1755, oo 1797 Klara Schierle v. Hchl.
- < Johann Radizi,
Chirurg in Hchl., dann Wirt u. Chirurg in Hlzl., * 1779, oo 1815 u.
1822 - < Maximilian Barth,
Chirurg, eröffnet 1838 eine Praxis in Hchl., * 1812, oo 1842 Theresia ...Mangold
v. Hchl. - < Josef Kuhn,
Wundarzt in Hchl., * 1842, oo 1872 Mathilde Knödler v. Hlzl. Angemerkt:
Kuhn baut das Hs. 113 (Gasthaus Rose)
Auch eine Beinamputation im Jahr 1852 ist belegt. Nachdem
eine Wundbehandlung von Chirurg Barth an einem Hchl. Patienten nicht
erfolgreich verlief, musste das Bein amputiert werden- der Patient überlebte
natürlich. Dabei fielen Kosten von ~ 28 fl. an, die von der Armenkasse
der Gemeinde beglichen wurde.
Soviel zum Thema „Bader" und "Wundärzte"
Badbrunnenstube - Badbrunnen – Wassergemeinschaft
Die Badbrunnenstube und Quellfassung im Boppschen
Garten
 Die
Quelle zur Versorgung der Badstube und des Badbrunnens entspringt aus
einer Stubensand-steinschicht. Diese Quellschüttung Die
Quelle zur Versorgung der Badstube und des Badbrunnens entspringt aus
einer Stubensand-steinschicht. Diese Quellschüttung
wurde gefasst und darüber eine sogenannte Brunnenstube gemauert.
Über Deichel (aus Holz gefertigte Röhren) wurde das Wasser dann,
einmal zum Badbrunnen und zur Badstube, welche sich in der Talaue unterhalb
d. B. Stube befand, geleitet.
Heute speist die Brunnenstuben-Quelle nur noch den
neuen Badbrunnen an der Holzleuter Straße.
(bis zum Abbruch des Boppschen Anwesen im Jahr 2021wurde auch deren
Garten-anlage aus der Brunnenstube bewässert.
Zum Bild: Im unteren Teil des Bildes sind deutlich
die Felsquader der Sandsteinformation zu erkennen. Das Wasser strömt
von links her unter den Felsen in den kleinen Sammelschacht.
Der Badbrunnen
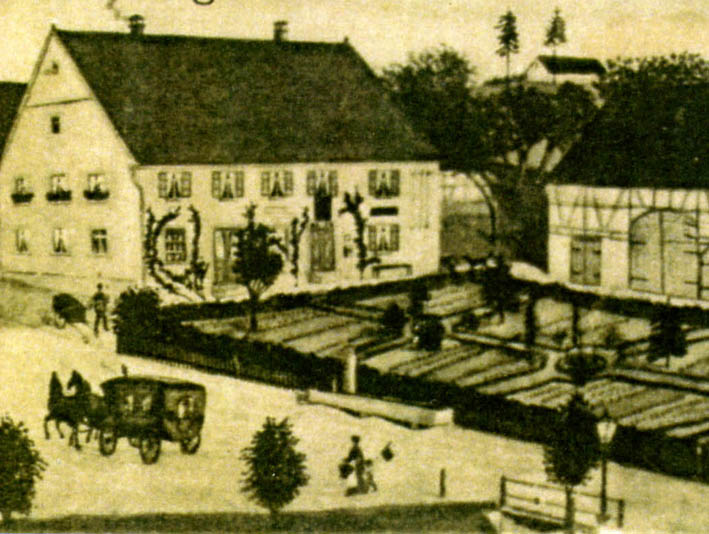 Man kann gut annehmen dass mit dem Bau der Brunnenstube sich
eine "Wassernutzungs-gesellschaft des laufenden Badbrunnens"-
so ein Akteneintrag- gegründet hat. Diese ließ einmal den Badbrunnen
aufstellen und die notwendige Deichelleitung verlegen. Die Gemeinschaft
umfasste vermutl. die Hausanwesen der gesamt. Küfergasse und einen
Teil der Schlossgasse. (Bewohner vom obere Schlossteil hatte (zumind.
zeitweise) eine eigene Brunnenanlage. Man kann gut annehmen dass mit dem Bau der Brunnenstube sich
eine "Wassernutzungs-gesellschaft des laufenden Badbrunnens"-
so ein Akteneintrag- gegründet hat. Diese ließ einmal den Badbrunnen
aufstellen und die notwendige Deichelleitung verlegen. Die Gemeinschaft
umfasste vermutl. die Hausanwesen der gesamt. Küfergasse und einen
Teil der Schlossgasse. (Bewohner vom obere Schlossteil hatte (zumind.
zeitweise) eine eigene Brunnenanlage.
Für einen Teil dieser Genossen findet sich
ein Eintrag im Servitutenbuch S. IV.
Hierin
sind Deichelnutzungsrechte in der Parz. 209/2 für die Häuser
23, Michael Hasenmaier-"Schneiderbauer"-(Knödler),
für das Haus 24, "Nullenmann"- Jos. Bihlmaier-(Geiger),
für d. Haus 25 mit dem Schmied Sebast. Strampfer -(Lutz) und für
das 26, Anton Klotzbücher - spät. Haus Seibold eingetragen.
Der Badbrunnen diente also zur Wasserversorgung für Mensch
und Vieh in d. "Küfergasse" und der Bewohner am unteren Schlossberg.
Der Badbrunnen bestand aus einem langen Brunnentrog mit dem Brunnenstock
am oberen Trogende. Er stand am Fuße des Schloss-bergs unmittelbar am
Ziergarten der ehemaligen Poststelle. Das Zuleitungsrohr war erhöht
im Brunnenstock angebracht. So konnte man das Wasser auch in Gefäße
einfüllen. Das Überwasser lief in den nahen Käferbach.
Angemerkt: Beim Bau der "Molke" (um
1890) mit einem Dampfmaschinenhaus, wurde vom Badbrunnen weg eine Wasserversorgungsleitung
zu der neuen "Molke" verlegt. (Die Leit-ungen waren bereits
als Guß - od. Stahlrohren gefertigt - Qu.
u.a. Jos. Ehmann - 2015)
.......................
Die erste private
„Wasserleitungs – Gesellschaft“
in Heuchlingen
1911 wurde für die gesamte Küfergasse das
erste private Wasserversorgungssystem gebaut. Dazu wurde im Gewann
der "Auftweid" - in der Parz. 390-
eine Quelle in einem Reservoir gefasst. Von hier aus führte sodann eine
Hauptleitung am Bach entlang zur Küfergasse und weiter vor bis zum „Adler“.
Das Leitungsnetz erreichte dann alle Häuser entlang der Küfergasse,
den „Adler“ und auch noch das damalige Haus "Klopfer" an der
Alten Mögglinger Straße.
Die gesamte Installation
erfolgte damals unter der Leitung des Schlossermeisters Bernhard Ohnewald.
Dabei ließ dieser auch eine Stichleitung in einen Schacht
im Garten über seinem Haus am Bergle verlegen. Aus diesem Schacht konnte-
neben dem Ohnewald, auch der "Lauchbauer" von seinem Stall
aus mit einer Handpumpe Wasser entnehmen. Zeitzeugen wissen auch von
einem Anschluss in den Keller des Kindergartens aus eben diesem Schacht.
Dieser, sozusagen private Schacht, ist später dann eingegangen.
Interessant dabei: Beim
ersten Öffnen des Hauptschiebers, gab Ohnewald mit der Pistole Signalschüsse
ab. In allen in Frage kommenden Häusern wurden daraufhin die Hähne geöffnet.
Das Wasser konnte fließen.
Wie ging es weiter mit der
Wasserversorgung im Dorf? Erst in den 1950er-Anfangsjahren war der komplette
Ausbau der Wasserversorgung für das ganze Dorf (inbesonders den
Schloßteil und den Gänsbühl) vollständig abgeschlossen.
Die hier genannte private Wasserversorgung verlor ihre Bedeutung. Zuletzt
versorgte nur noch der "Schneiderbauer" Knödler seinen
Viehstall und weitere Hofteile mit Wasser aus der Quellfassung.
Außer Knödler nutzte dann noch der "Adlerwirt"
Jettinger die Quellfassung, bis zuletzt hauptsächlich zur Kühling
der Wurst - und Konservendosen in seinem Schlachtbetrieb.
*Das Ende der privaten Wasserversorgung in der Küfergasse: 2017
wurde im Zuge von Grabarbeiten (Leitungsrepar.) im Garten b. Mederveit-Weber
durch den eingesetzen Bagger die Hauptleitung der Quellfassung abgerissen.
Jettinger ließ daraufhin (wohl n. entspr. Abssprachen) die Leitung
beim Reservoir kappen. *Aussage
v. S. Altmann u. J. Ehmann u. A. Knödler.
105 Jahre also tat diese private Wasserversorgung, wenn zuletzt
auch nur noch eingeschrängt, ihre Dienste. Eine weitere Ära
ging damit zu Ende.
zurück z. Brunnen Navigation
Weiter zur Alten Mögglinger Straße, zum Bergle und auf
den Gänsbühl.
|
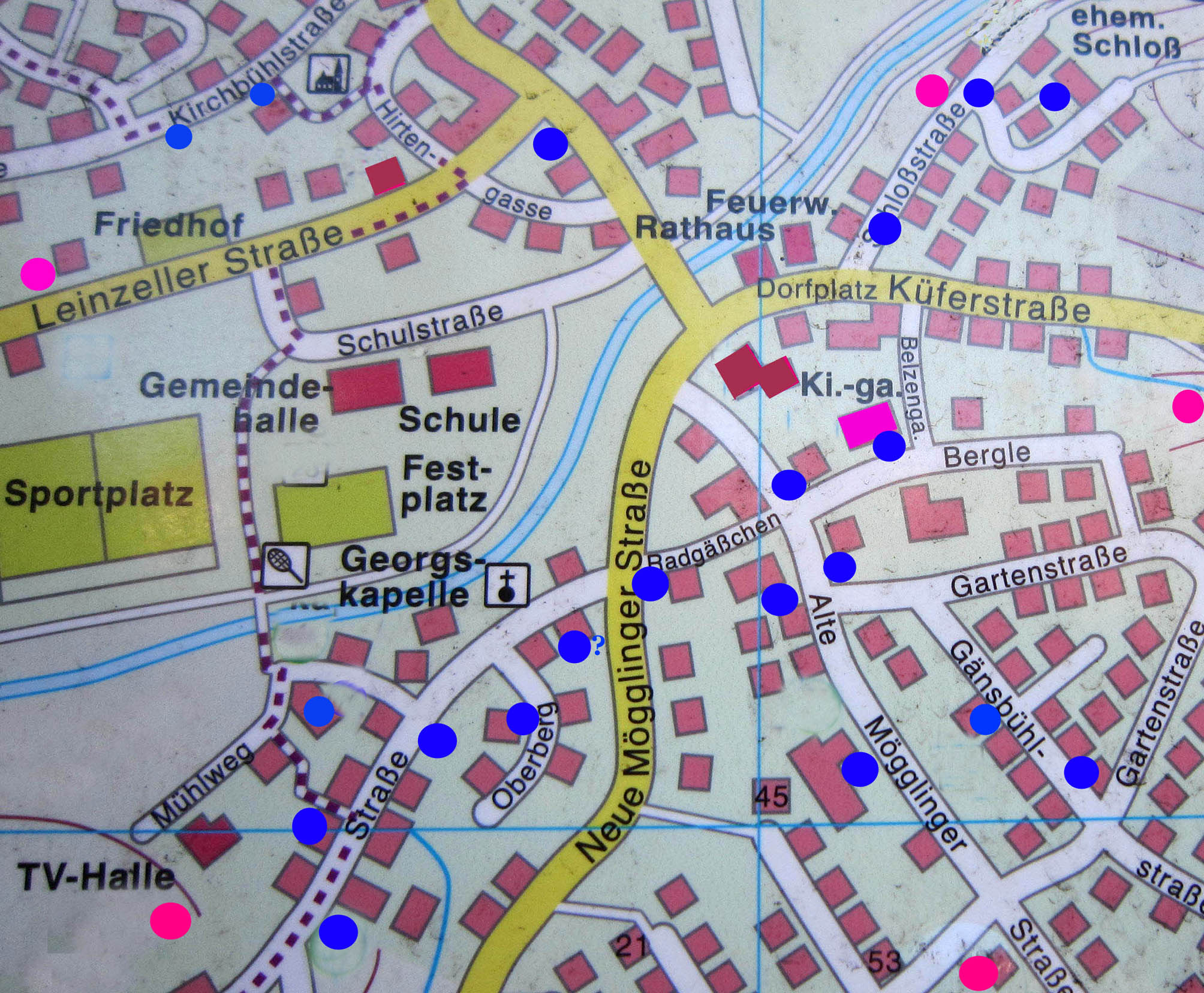
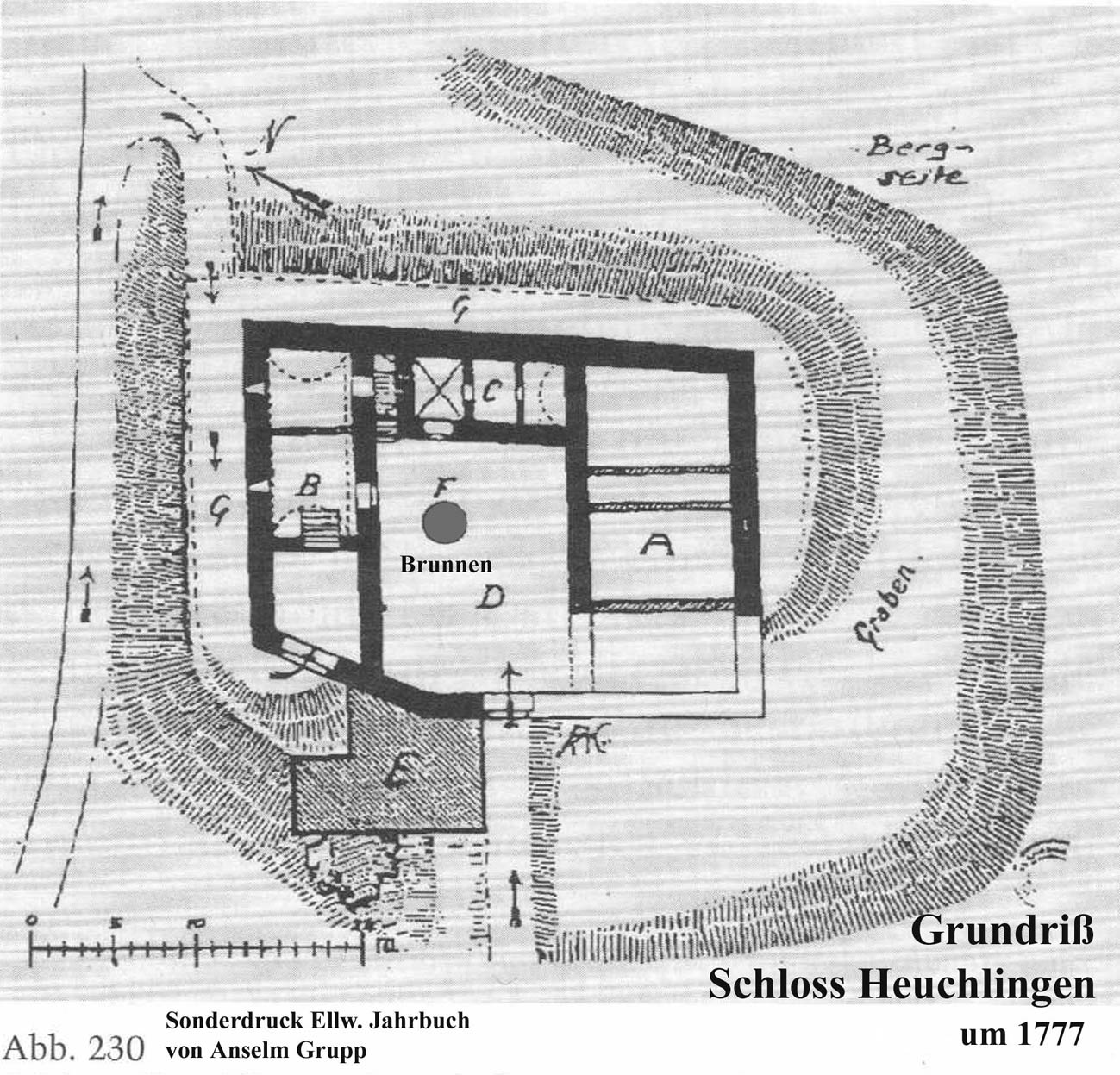
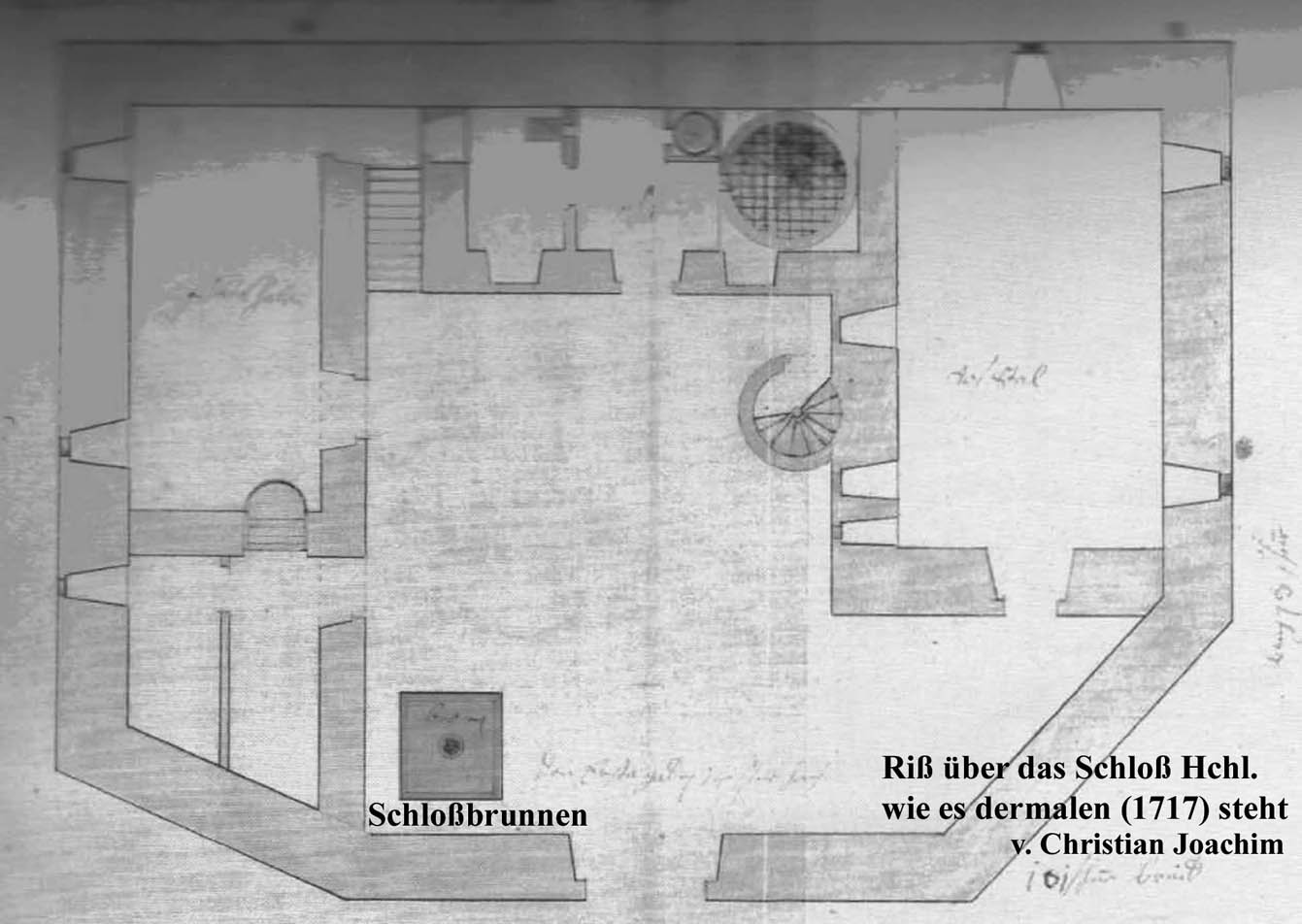

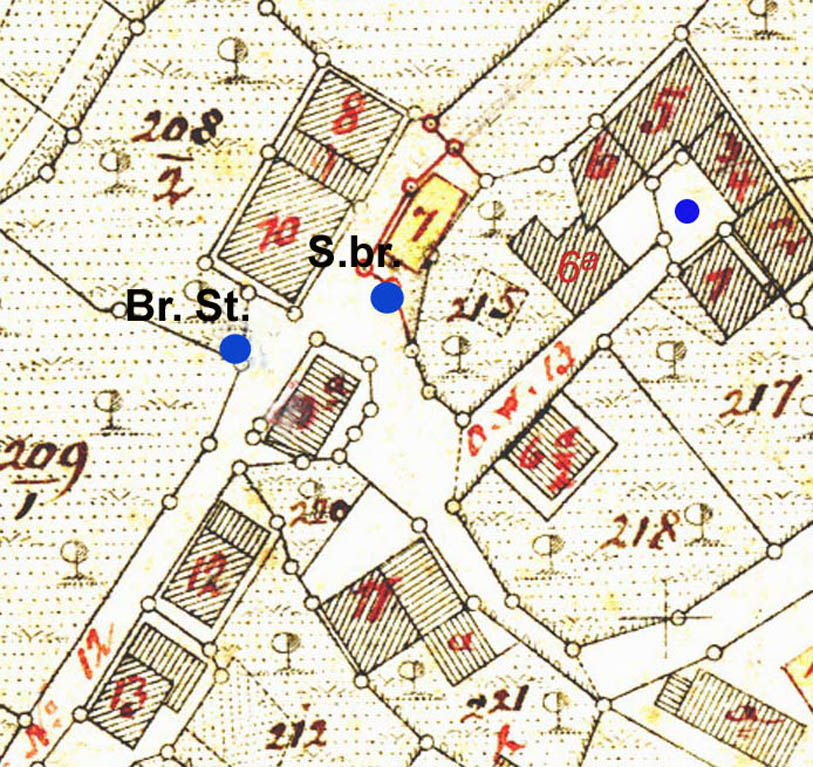
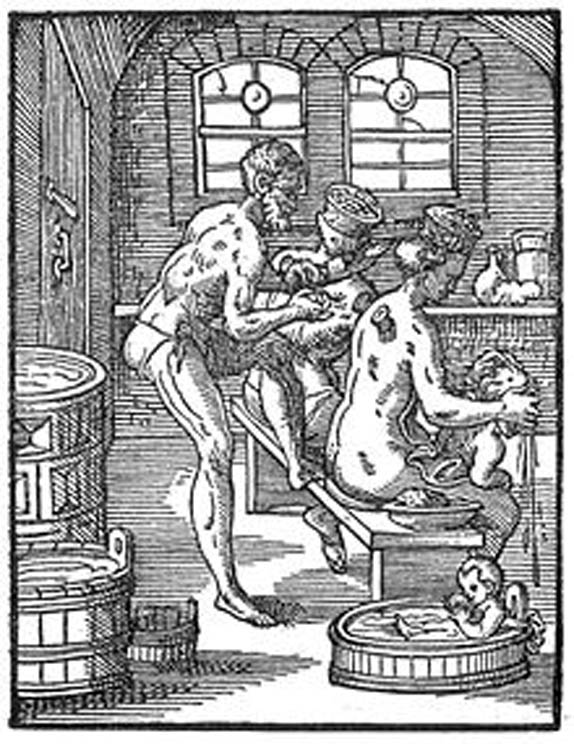
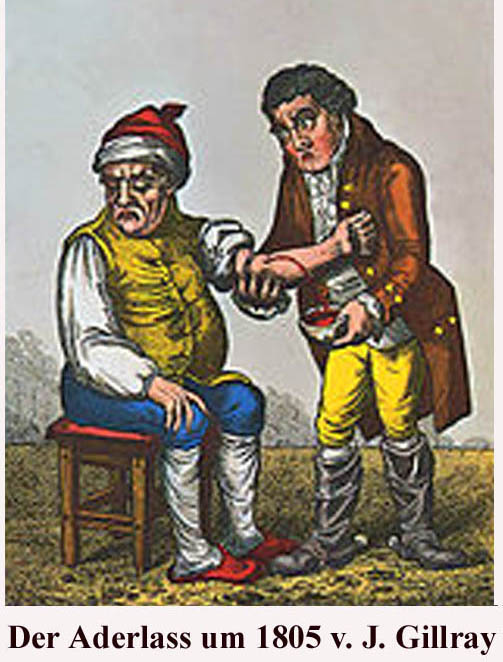
 Die
Quelle zur Versorgung der Badstube und des Badbrunnens entspringt aus
einer Stubensand-steinschicht. Diese Quellschüttung
Die
Quelle zur Versorgung der Badstube und des Badbrunnens entspringt aus
einer Stubensand-steinschicht. Diese Quellschüttung